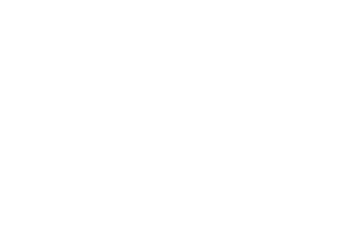Arbeiten in Spannungsverhältnissen 7:
Forschung zur Kulturvermittlung zwischen Wirkungsnachweis und Ergebnisoffenheit
«Cultural heritage institutions are increasingly seen as instruments for government policies on social inclusion, cohesion and access […] and required to present evidence of their performance. […] Funding levels across the sector are contingent on being able to present such evidence.» (Brown 2007, S.23)
Im Text 6.FV wurde darauf hingewiesen, dass die Forschung im Bereich Kulturvermittlung ein vergleichsweise junges Phänomen ist. Erst in den letzten 15 Jahren wachsen die Bemühungen sowohl um forschungsbasierte Analysen gegenwärtiger Praxis als auch um eine differenzierte Geschichtsschreibung. Dominiert traditionell in den pädagogischen Berufen eine Skepsis gegenüber Theorie (Patry 2005), interessieren sich gegenwärtig mehr und mehr Akteur_innen aus dem Arbeitsfeld der Kulturvermittlung für Anregungen, begriffliche Reflexionen und Argumentationsgrundlagen für die Ausgestaltung und Begründung ihrer Praxis. So wurde zum Beispiel im Jahr 2012 der → Salon Kulturvermittlung, eine virtuelle Diskussion zu theoretischen Grundlagen der Kulturvermittlung in Österreich gegründet.
Im → Text 7.5 wurde bereits das Spannungsverhältnis zwischen Legitimationsbestrebungen und dem Anspruch der Ergebnisoffenheit von Forschung in der Kulturvermittlung erwähnt. Im Folgenden soll das Forschungsfeld unter dieser Perspektive etwas eingehender beschrieben werden.
«Besucherorientierung» ist international ein Schlüsselbegriff in der Debatte um die Zukunftsfähigkeit von öffentlich geförderten Kulturinstitutionen geworden. So sprach zu Beginn des 21. Jahrhunderts David Anderson (damals Leiter der Vermittlungsabteilung des Victoria and Albert Museum London, heute Generaldirektor der staatlichen Museen Wales) von einer Verschiebung des Museums von «Object focused» zu «User focused» (→ Anderson 2000). Damit korrespondieren aktuelle Selbstpositionierungen des Kulturmanagements im deutschsprachigen Raum, etwa bei der Suche nach einer Position «zwischen kultureller Bildung und Kulturmarketing» (Mandel 2005) und der Hinwendung zur Kunst- und Kulturvermittlung (Kittlausz, Pauleit 2006). Die Idee der Besucherorientierung ist gekoppelt mit der Konzeption der Kulturinstitutionen als gesellschaftliche Lernorte, die in Abgrenzung zu Schule und Hochschule als idealtypisch für ein selbstmotiviertes «lebenslanges Lernen» (John, Dauschek 2008) gesetzt werden, mit den entsprechenden Transferwirkungen auf individuelle Leistungsbereitschaft und Sozialverhalten. Daran orientiert sich entsprechend auch ein wesentlicher Teil der Forschungsaktivität in der Kulturvermittlung. Denn wie im Eingangszitat zu diesem Text angedeutet: Je stärker die öffentliche Finanzierung der Institutionen über deren Transfer- und Bildungseffekte legitimiert ist, desto dringlicher wird der Nachweis dieser Effekte. Ein weiterer Teil konzentriert sich auf den Nachweis und die Förderung der → reproduktiven Funktion von Kulturvermittlung. Zu finden sind vor allem Evaluationen der Bildungswirkung von Vermittlungsprojekten auf die Teilnehmenden oder Tests von Displays, Aufführungsorten und Infrastrukturen mit Blick auf die Nutzungsweisen durch die Besucher_innen mit den Zielen der Nutzungsoptimierung und der Publikumserweiterung (vgl. exemplarisch für den Museumsbereich die diesbezüglichen Angebote der → Arbeitsgruppe für empirische Bildungsforschung).
Evaluationen und Bestandesaufnahmen sind nicht nur die am weitesten verbreitete, sondern auch die älteste Form der auf Vermittlung bezogenen Forschungstätigkeit. So entstanden in Grossbritannien und in den USA bereits in den 1940er Jahren Studien zum Bildungsauftrag von Museen und zu deren Status Quo in Sachen Vermittlung, sowohl von Regierungsorganisationen und Verbänden finanziert (Low 1942) als auch als selbstbeauftragte Forschung von Einzelpersönlichkeiten, die das Museum neu denken wollten (Wittlin 1949).
Neben quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden der Sozial- und Marktforschung, wie dem Einsatz von Fokusgruppen, dem Beobachten des Verhaltens von Besucher_innen, dem Abfragen ihrer demografischen Daten und ihrer Einstellungen, gehören aus der Kognitionspsychologie abgeleitete Untersuchungsmethoden1 wie die des «Lauten Denkens» (Dufresne-Tassé, Lefebvre 1994), bei denen Besucher_innen zur Teilnahme an experimentellen Anordnungen als Proband_innen motiviert werden, zum Methodenset der Besucher_innenforschung. Ein aktuelles Beispiel, das neurowissenschaftliche, kultursoziologische und künstlerische Verfahren zur Bearbeitung einer marketingstrategischen Fragestellung verknüpfte, ist die an der Fachhochschule Nordwestschweiz angesiedelte, in Kooperation mit dem Kunstmuseum St. Gallen durchgeführte Studie → eMotion (Tschacher et al. 2012).
Grundsätzlich sind in der Besucher_innenforschung zwei Perspektiven zu unterscheiden: Eine, die historisch ältere, versteht die Besucher_innen als mehr oder weniger homogene Gruppe, deren Bedürfnisse und Verhalten beschrieben und deren Lernzuwächse gemessen werden können. Die andere, seit den 1990er Jahren dominierende, versteht Besucher_innen als heterogene Gruppe, deren Mitglieder aktiv Inhalte interpretieren und sich die Kulturinstitutionen performativ aneignen. Forschung wird entsprechend als deutend und bedeutungskonstruierend und nicht als objektiv beschreibend verstanden (Harrasser et al. 2012, S.15). Auch die letztgenannten Zugänge werden bislang vornehmlich für das Erbringen von Wirkungsnachweisen eingesetzt. Um staatlich finanzierten Museen, Bibliotheken und Archiven vor diesem Hintergrund ein von ihnen selbst handhabbares Werkzeug für den geforderten Wirkungsnachweis zu geben, entwickelte zum Beispiel Eilean Hooper-Greenhill an der School of Museum Studies der University of Leicester im Auftrag des damaligen Council for Museums, Archives and Libraries das Instrument der → Generic Learning Outcomes (Hooper Greenhill 2007). Es handelt sich dabei um von den Institutionen selbst durchführbare Erhebungen unter Besucher_innen, die entlang von sechs Kategorien, wie etwa «Kenntnis und Verstehen» oder «Einstellung und Werte», unterschiedliche Dimensionen informellen Lernens erfassen.2 Zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung wurden die Generic Learning Outcomes von rund der Hälfte aller englischen Museen verwendet. Aber auch im deutschsprachigen Raum finden sie Verbreitung (z.B. im Grazer Kindermuseum → Frida und Fred, in Kooperation mit der → Universität Graz). Auch wenn der Ansatz der Generic Learning Outcomes die Besucher_innen als aktiv und heterogen entwirft, bleibt anzumerken, dass sie zwar potentiell Anlässe zur Selbstreflexion für die Institutionen und die Kulturvermittler_innen (wie auch für die Nutzer_innen) bieten, aber die Ergebnisoffenheit als leitendes Kriterium für wissenschaftliches Arbeiten zuweilen schwierig zu gewährleisten ist. Dies vor allem, wenn die Existenz der beforschten Einrichtung implizit oder explizit an die positive Evaluation ihrer Bildungswirkung gekoppelt wird (Loomis 2002). Forschung ist in diesen Fällen zuweilen schwer von einer Dienstleistung zu unterscheiden, da die Setzungen und Absichten der jeweiligen Auftraggeber_innen selten selbst zum Gegenstand der Analyse und Kritik gemacht werden. Gering ist häufig auch ihr Grad von Selbstreflexivität – zum Beispiel in Bezug auf die → normativen Setzungen durch die verwendeten Analysekategorien. Sie fällt hinter den «Reflexive Turn» (Bachmann-Medik 2006) zurück, also hinter die seit mehreren Jahrzehnten etablierte kritische Selbstreflexion des Wahrheitsanspruchs von Forschung, der Autorität und Macht der Forscher_innen und deren Wirkungen auf die Wissensproduktion. Dementsprechend trägt sie tendenziell weniger zur einem Selbstverständnis von Kulturvermittlung als eigenständiger und kritischer Praxis bei, als dass sie Gefahr läuft, diese entlang institutioneller und politischer Zielvorstellungen festzuschreiben (Mastai 2007).
Doch finden sich zunehmend Beispiele von Forschung zur Kulturvermittlung, welche ihre Arbeit auf der Basis des Reflexive Turn entfalten. Manche bleiben dabei in der etablierten Konstellation von Forschenden und Beforschten, aber leisten anstelle eines Wirkungsnachweises eine kritische Analyse der Kultur, ihrer Institutionen und Vermittlungspraktiken. So zum Beispiel das Projekt «Science with all Senses – Gender and Science in the Making», das mit ethnomethodologischen Mitteln Wissensaneignung von Kindern in Wiener Museen entlang der Kategorien Klasse, Ethnizität und Geschlecht untersuchte (Harrasser et al. 2012).
Andere Projekte weisen sich dadurch aus, dass sie mit den Mitteln der → Aktionsforschung versuchen, Forschung und Entwicklung von Kulturvermittlung stärker zu verzahnen, indem sie die Praktiker_innen der Vermittlung als Forschende einbeziehen. Auch existieren Ansätze, die Besucher_innen aus der Rolle der Proband_innen zu lösen und auf deren Mitarbeit und Mitdenken basierende Forschungsdesigns zu entwickeln. So setzte das Schweizer Projekt «Ästhetische Kommunikation im Kindertheater» kreatives Schreiben, Zeichnen und weitere freie Gestaltungsmittel ein, um den individuellen Wahrnehmungen der Kinder beim Theaterbesuch nicht nur aus Beobachtungen, sondern aus deren eigenen Artikulationen auf die Spur zu kommen (Baumgart 2012). In einem landesweiten, wissenschaftlich begleiteten Modellprogramm in England mit dem Titel → enquire (2004–2011) arbeiteten Künstler_innen, Schüler_innen, Student_innen, Wissenschafter_innen, Lehrer_innen und Kunstvermittler_innen unter dem Motto «Learning in Galleries» zusammen. Dabei entwickelten Jugendliche experimentelle interpretative Werkzeuge für die Arbeit mit dem Publikum. Die Projekte sind an die Mitarbeit der Schüler_innen geknüpft und erforschen gleichzeitig ihr Lernverhalten und die Dynamiken der Zusammenarbeit zwischen Museum und Schule. Sie hinterfragen aber auch die Deutungshoheit der Museen und ihrer tradierten Vermittlungspraktiken. Ein Projekt, welches letzteren Aspekt besonders in den Blick nimmt, ist → «Tate Encounters: Britishness and Visual Culture» (Dewdney et al. 2012), das die Tate Britain von 2007 bis 2010 in Kooperation mit der London South Bank University und der University of the Arts London durchführte. In diesem untersuchte eine Forschungsgruppe, die sich aus Wissenschafter_innen, Museumspersonal und Studierenden mit Migrationshintergrund im weitesten Sinne3 zusammensetzte, wie über die Ausstellungsweisen des Museums → Britishness hergestellt wird. Die Forschungsergebnisse stellen die Cultural → Diversity Policy des Museums grundsätzlich in Frage und bieten Perspektiven für eine veränderte vermittlerische und kuratorische Arbeit in Ausstellungsinstitutionen. Tate Encounters war von den Ansätzen der → normativen Setzungen kritischen Museologie informiert und versuchte auf dieser Grundlage, die institutionelle Praxis weiterzudenken. Das Projekt verfolgte den Anspruch, die Hierarchien zwischen Forschenden und Beforschten, Lehrenden und Lernenden durchlässig zu machen und die oben beschriebene «Besucherforschung» als «Forschung in Zusammenarbeit mit Besucher_innen» zu betreiben. Dabei war die Bearbeitung und Reflexion der zwangsläufig vorhandenen Hierarchien zwischen professionellen Forschenden und Teilnehmenden aus anderen Bereichen ein integraler Bestandteil. So wurden zum Beispiel die beteiligten Jugendlichen als «Ko-Forschende» methodisch ausgebildet. Ähnliche Projekte finden in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum statt. So war das Forschungsprojekt zur Vermittlung auf der documenta 12 diesem Anspruch verpflichtet (Wieczorek et al. 2009; Mörsch et al. 2009). Bildung wurde von den Kurator_innen der d12 zu einem von drei leitenden Motiven der internationalen Ausstellung zeitgenössischer Kunst erklärt. Daraus resultierte ein Vermittlungskonzept, das den Dialog über Kunst und die Debatte über Bildung gegenüber der autorisierten Vermittlung von Wissen favorisierte. Vermittlung verstand sich dabei als «Kritische Freundin» (Mörsch 2008) im Verhältnis zur Ausstellung. Zwanzig der freiberuflich arbeitenden Vermittler_innen führten ein Teamforschungsprojekt durch, das durch Methoden der Vermittlung – als Forschung, als Performance und als Intervention – versuchte, auf Veränderung der Praxis und ihrer Verhältnisse angelegte Analysen im Sinne einer «militanten Untersuchung» (→ Malo 2004; → Graham 2010) zu betreiben. Spätestens an diesem Beispiel wird deutlich, dass ein Ziel solcher Forschungszugänge in der Kulturvermittlung die → Ermächtigung der an ihnen Beteiligten darstellt. So auch bei dem auf Aktionsforschung basierendem Projekt «Kunstvermittlung in Transformation», das von 2009 bis 2011 unter Mitwirkung von vier Schweizer Kunsthochschulen und fünf Museen stattfand und sich zum Ziel setzte, die Vermittlungspraxis in den Museen und die Beschäftigung der Hochschulen mit dem Bereich der Musemsvermittlung gemeinsam mit den Praktiker_innen forschungsbasiert weiterzuentwickeln (Settele et al. 2012). Viele der Beteiligten gaben zum Ende des Projektes an, dass sich der Status des Bereichs Kulturvermittlung in ihren Institutionen verbessert habe. Eine Kollegin aus dem Museumsbereich beschrieb, dass es durch den Verweis auf den Forschungszusammenhang leichter fiel, Praxisexperimente und die Auseinandersetzung mit Theorie in ihrem Team zu motivieren.4
Praxisforschung bietet keinen Ausweg aus der Spannung zwischen dem Nachweis erwünschter Wirkungen und der Ergebnisoffenheit von Forschung. Sie kann jedoch die Entfaltung von Reflexionsfähigkeit im Praxisfeld unterstützen, anwendbare Ergebnisse produzieren und so zu seiner Weiterentwicklung beitragen, ohne sich dabei in den Dienst institutioneller und kulturpolitischer Imperative zu stellen, aber auch ohne eine Unberührtheit von diesen zu fingieren. Sie birgt daher das Potential, das Produktivmachen von Spannungsverhältnissen auch auf Forschungsebene fortzusetzen.
1 Vgl. hierzu beispielsweise die Publikationen und Projekte des Forschungsschwerpunktes Psychologische Ästhetik und kognitive Ergonomie der Universität Wien oder der Gesellschaft für empirische Ästhetik → http://science-of-aesthetics.org [14.10.2012].
2 Für eine detaillierte Auflistung sowie eine Kritik dieser Kategorien → siehe Text 3.FV.
3 Zwei Bedingungen bestanden für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt: Die Studierenden mussten aus einer Familie stammen, die nach England eingewandert ist (von wo, spielte keine Rolle) und in der sie die ersten sind, die eine Universität besuchen.
4 An einem anderen Museum wurde für drei Jahre neu die Stelle einer «Kuratorin für Vermittlung» eingerichtet → siehe Text 5.FV.
Literatur und Links
Der Text basiert in Teilen auf folgenden bereits erschienenen Beiträgen:- Mörsch, Carmen: «In Verhältnissen über Verhältnisse forschen: ‹Kunstvermittlung in Transformation› als Gesamtprojekt», in: Settele, Bernadett, et al. (Hg.): Kunstvermittlung in Transformation. Ergebnisse und Perspektiven eines Forschungsprojektes, Zürich: Scheidegger & Spiess, 2012, S.299–317
- Anderson, David: Networked Museums in the Learning Age. Vortrag anlässlich der EVA Conference, Edinburgh, 2000 [10.10.2012]; → MFV0701.pdf
- Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns – Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Hamburg: Rowohlt, 2006
- Baumgart, Charlotte: «Den Kindern ein Sprachrohr geben», in: Sack, Mira; Rey, Anton (Hg.): Ästhetische Kommunikation im Kindertheater, subTexte 07, Zürich: Institute Performing Arts, Zürcher Hochschule der Künste, 2012, S.35–44
- Brown, Stephen: «A Critique of Generic Learning Outcomes», in: Journal of Learning Design, Jg. 2, Nr. 2, 2007, S.23
- Dufresne-Tassé, Colette; Lefebvre, André: «The Museum in Adult Education: a psychological study of visitor actions», in: International Review of Education Jg. 40, Nr. 6, 1994, S.469–484
- Dewdney, Andrew, et al. (Hg.): Post Critical Museology: Theory and Practice in the Art Museum, London/New York: Routledge, 2012
- Graham, Janna: «Spanners in the Spectacle: Radical Research at the Front Lines», in: Fuse Magazine, April 2010 [10.10.2012]; → MFV0704.pdf
- Harrasser, Doris, et al. (Hg.): Wissen Spielen. Untersuchungen zur Wissensaneignung von Kindern im Museum, Bielefeld: Transcript, 2012
- Hooper Greenhill, Eilean (Hg.): Museums and Education – Purpose, pedagogy, performance, London: Routledge, 2007
- John, Hartmut; Dauschek, Anja (Hg.): Museen neu denken. Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit, Bielefeld: Transcript, 2008
- Kittlausz, Viktor; Pauleit, Winfried (Hg.): Kunst – Museum – Kontexte. Perspektiven der Kunst und Kulturvermittlung, Bielefeld: Transcript, 2006
- Loomis, Ross J.: «Visitor Studies in a political world. Challenges to Evaluation Research», in: Journal of Interpretation Research, Jg. 7, Nr. 1, 2002, S.31–42
- Low, Theodore: The Museum as a Social Instrument. A study undertaken for the Committee on Education of the American Association of Museums, New York: Metropolitan Museum of Art, 1942
- Malo de Molina, Marta: Common notions, part 1: Workers-inquiry, co-research, consciousness-raising, 2004 [10.10.2012]; → MFV0703.pdf
- Mandel, Birgit (Hg.): Kulturvermittlung – zwischen kultureller Bildung und Kulturmarketing. Eine Profession mit Zukunft, Bielefeld: Transcript, 2005
- Mastai, Judith: «There Is No Such Thing as a Visitor», in: Pollock, Griselda; Zemans, Joyce (Hg.): Museums After Modernism. Strategies of Engagement, Oxford: Blackwell, 2007, S.173–177
- Mörsch, Carmen: «Regierungstechnik und Widerstandspraxis: Vielstimmigkeit und Teamorientierung im Forschungsprozess», in Pinkert, Ute (Hg.): Körper im Spiel. Wege zur Erforschung theaterpädagogischer Praxen, Uckerland: Schibri, 2008, S.175–188
- Mörsch, Carmen, und das Forschungsteam der documenta 12 Vermittlung (Hg.): Kunstvermittlung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12, Zürich: diaphanes, 2009
- Patry, Jean-Luc: «Zum Problem der Theoriefeindlichkeit der Praktiker», in: Heid, Helmut; Harteis, Christian (Hg.): Verwertbarkeit, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005, S.143–161
- Settele, Bernadett, et al. (Hg.): Kunstvermittlung in Transformation. Ergebnisse und Perspektiven eines Forschungsprojektes, Zürich: Scheidegger & Spiess, 2012
- Tschacher, Wolfgang, et al.: «Physiological correlates of aesthetic perception in a museum», in: Journal of Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, Nr. 6, 2012, S.96–103, doi: 10.1037/a0023845
- Wieczorek, Wanda, et al.: Kunstvermittlung 1. Arbeit mit dem Publikum, Öffnung der Institution. Formate und Methoden der Kunstvermittlung auf der documenta 12, Zürich: diaphanes, 2009
- Wittlin, Alma S.: «The Museum: Its history and its tasks in education», in: Mannheim, Karl (Hg.): Education, International library of sociology and social reconstruction, London: Routledge & Kegan Paul, 1949
- Arbeitsgruppe für empirische Bildungsforschung, Heidelberg [8.10.2012]
- Fachhochschule Nordwestschweiz, Studio eMotion [10.10.2012]
- Kindermuseum Graz, Frida und Fred [10.10.2012]
- Museums, Libraries and Archives Council (MLA), GB, Generic Learning Outcomes [10.10.2012]
- Programm enquire, United Kingdom [10.10.2012]
- Salon Kulturvermittlung, Österreich [10.10.2012]
- Schrittesser, Ilse: Learning Outcomes: Idee, Nutzen und Möglichkeiten, Vortrag, Universität Wien, 6.12.2007 [7.10.2012]
- Tate Britain, London, Tate Encounters [10.10.2012]