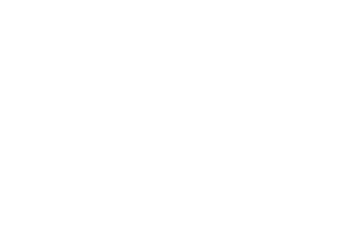Arbeiten in Spannungsverhältnissen 3:
Versteckte Lernziele der Kulturvermittlung
«Das einst umkämpfte ‹Recht auf Bildung› ist zu einer lebenslangen Bildungspflicht geworden, die, bei Strafe eigenen Untergangs, das flexible und marktgängige Lernsubjekt fordert.» (→ Merkens 2002)
Im Text 2.FV wurde dargelegt, dass im Kontext von Adressierung in der Kulturvermittlung die unausgesprochene Forderung an die Eingeladenen, den Einladenden ähnlich zu werden, in einer hegemoniekritischen Perspektive reflektiert werden muss. In diesem Kapitel soll diese Problematik mit Blick auf die Inhalte von Kulturvermittlung vertieft und veranschaulicht werden. In den Fokus rücken dabei versteckte Lehrinhalte beziehungsweise Lernziele der Kulturvermittlung am Beispiel des «lebenslangen Lernens».
2010 legte der deutsche Museumsbund die Übersetzung und Erweiterung eines europäischen Handbuchs zu → Museen und lebenslangem Lernen vor, als Ergebnis eines von der Europäischen Union geförderten gleichnamigen Projektes.1 Darin wird «lebenslanges Lernen» als informelles (d. h. im sozialen Kontext stattfindendes und nicht zertifiziertes) Lernen definiert und die «Bedeutung und Tragweite des Lernens als ein das ganze Leben begleitender Prozess» hervorgehoben. Das Handbuch bietet neben Praxistipps für die Erwachsenenbildung im Museum zahlreiche Hinweise auf geschichtliche und gegenwärtig wirksame Machtverhältnisse in Ausstellungsinstitutionen, welche die Bildungsarbeit darin beeinflussen. Es scheut dabei (als eine der wenigen Publikationen dieser Art) auch vor der expliziten Benennung von Rassismus nicht zurück (Museumsbund 2010, S.87). Es fordert, «abzusichern, dass die Vielfalt des Museumspersonals der Vielfalt der Besucher_innen, die das Museum anziehen will, entspricht» (Museumsbund 2010, S.15). Es betont die Anforderung an eine zeitgemässe Museumsarbeit, grundsätzlich allen Besuchenden, aber insbesondere den Teilnehmenden in Vermittlungsprojekten bewusst auf Augenhöhe zu begegnen und die Effekte ungleicher Voraussetzungen dabei zu bedenken. Es benennt die Befreiungspädagogik Paulo Freires (Freire 1974) als Beispiel für die im Museum gegenwärtig leitenden Lernkonzepte. Das Handbuch könnte unter diesen Gesichtspunkten als von der Idee einer Kulturvermittlung als kritischer Praxis informiert bezeichnet werden. Gleichzeitig aber fehlt jeder Hinweis auf seit zwei Jahrzehnten artikulierte Kritiken am Leitmotiv des Buches, dem Konzept des lebenslangen Lernens selbst und der damit einhergehenden Betonung der Wichtigkeit von → Soft Skills. Die Autor_innen, beide aus dem Arbeitsfeld der Museumsberatung, beschreiben im Vorwort das diesbezügliche Potential von Museen und Ausstellungshäusern aus ihrer Sicht: «Museen bieten die idealen Bedingungen für ‹informelles Lernen›. Besucher_innen verlassen das Museum mit einem Wissenszuwachs, sie haben Fähigkeiten, Verständnis oder Inspiration erlangt, die einen positiven Einfluss auf ihr Leben haben» (Museumbsbund 2010, S.11, Hervorhebung durch die Verfasserin). Auch wenn das hier als Beispiel aufgeführte Handbuch und andere, ähnliche Publikationen gerade die radikale Unterschiedlichkeit der Lernenden als ein besonderes Potential der Erwachsenenbildung hervorheben, so wird doch unhinterfragt vorausgesetzt, dass die Bereitschaft zum «lebenslangen Lernen» für sie alle gleichermassen erstrebenswert sei und dass es für alle darum gehe, ihre Persönlichkeit durch den Museumsbesuch so weiterzuentwickeln, dass die individuellen Voraussetzungen dafür optimiert werden. Dieser blinde Fleck erscheint weniger zufällig denn als ein Symptom für ein im Wortsinn «verstecktes» Lernziel der Kulturvermittlung: Die Ausbildung eines → Habitus, der charakteristisch ist für den «Homo Flexibilis» (Sennett 1998), den sich selbst immer wieder neu erfindenden, anpassungsfähigen Menschen, der in einer auf «Kurzfristigkeit und raschen Wechsel angelegten postindustriellen Ökonomie» (→ Ribolits 2006, S.121) überleben kann, ohne dem Gemeinwesen zur Last zu fallen. Die mit dem Wandel von einer fordistischen zu einer → postfordistischen Produktionsweise einhergehende, zunehmende Flexibilisierung der Organisation und Produktion von Arbeit führt dazu, dass «die Bereitschaft, das eigene Arbeitsvermögen (permanent) zu bilden und zu optimieren» zu einer «wesentlichen Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe, also der Möglichkeit, im postfordistischen Kapitalismus überleben zu können» wird (Atzmüller 2011). Die Ausdehnung des Konzepts des «lebenslangen Lernens» lässt sich über die letzten vierzig Jahre hinweg verfolgen: von der bottom-up artikulierten Forderung der 1970er Jahre, lebenslang lernen zu dürfen (im Sinne von Gerechtigkeit beim Zugang zu Bildungsressourcen) über die seit den 1990er Jahren gesellschaftlich verankerte Vorstellung, lebenslang lernen zu können (im Sinne eines komplexeren Verständnisses von Lernbiografien, das die Vorstellung von sukzessive aufeinander aufbauenden berufsbezogenen Qualifikationsprozessen und Entwicklungsstadien relativiert) hin zum aktuellen Imperativ, lebenslänglich lernen zu müssen, um kein «Bildungsverlierer» (Quenzel, Hurrelmann 2010) zu sein und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die drei Konzepte sind in der Gegenwart gleichzeitig präsent und wirken ineinander. Dies erklärt zum Teil den positiven Zugang, wie er sich zum Beispiel im oben angeführten Handbuch artikuliert. Weiterhin wird dieser durch die zunehmende Verlagerung der Verantwortung für die Erfüllung der Anforderung, lebenslang zu lernen, in das einzelne Individuum als «unternehmerisches Selbst» (Bröckling 2007) gefördert.2 Sich einer entsprechenden Haltung zum eigenen Selbst zu verweigern, scheint keine sozial akzeptierte Option zu sein, hiesse es doch, sich der Planung eines unter gegenwärtigen Bedingungen mehrheitlich als «gelungen» erachteten Lebens aktiv zu verweigern. In dieser Perspektive ist es nur konsequent, dass neben fachlichem Wissen und Können die sogenannten Soft Skills, also Charaktereigenschaften und persönliche Haltungen, verstärkt zum Inhalt von Lernzielformulierungen und Bildungsbemühungen werden. Im hier als Beispiel dienenden Handbuch werden die zu erwartenden Resultate von informellen Lernprozessen Erwachsener im Museum beschrieben.3 Neben den naheliegenden sachbezogenen Lernzuwächsen, wie «umfangreicheres Wissen über ein bestimmtes Thema», «verbessertes Verständnis über spezifische Ideen und Konzepte» oder auch «verbesserte technische und andere Fähigkeiten» zielt die weitaus grössere Zahl der aufgeführten möglichen Lernergebnisse auf Veränderungen der persönlichen Befindlichkeiten und Haltungen der Lernenden: auf «erhöhtes Selbstbewusstsein», «Persönlichkeitsentwicklung», «Veränderung der Werte und Normvorstellungen», «Inspiration und Kreativität», «zwischenmenschlichen Austausch und Kommunikation», «Stärkung des Gemeinschaftsgefühls», «Identitätsfindung» bis hin zu «verbesserter Gesundheit und Wohlergehen» (Museumbsbund 2010, S.31). Mit dieser Verlagerung wird jede_r Besuchende zum Therapiefall und die Kulturinstitution zur therapeutischen Einrichtung, da die Optimierung der vielfältigen Merkmale nie völlig abgeschlossen sein wird. Wichtiger als die Auseinandersetzung mit den Inhalten einer Ausstellung scheint das Ziel zu sein, den Teilnehmenden Wege zur «kreativen Nutzung des personalen Potentials» beizubringen (→ Sertl 2007, S.9). Es handelt sich zudem bei Wohlbefinden, Selbstbewusstsein, Sozial- und Kommunikationsverhalten oder Wertvorstellungen um Aspekte, welche zur Privatsphäre gerechnet werden können, so dass ihre Zuschreibung, Beobachtung und Bewertung durch Mitarbeitende einer Kultureinrichtung auch als Übergriffe gesehen werden können. Dennoch wird nachgerade selbstverständlich artikuliert, dass Kulturvermittlung im Kontext lebenslangen Lernens dazu beitragen soll, die Bereitschaft der Einzelnen, weiter zu lernen, zu steigern.
Dass gerade der Kulturvermittlung in diesem Zusammenhang besonderes Potential zugesprochen wird, ist keineswegs zufällig. War die Künstlerfigur im 19. Jahrhundert, zur Zeit des Industriekapitalismus, noch ein Gegenbild zum Unternehmertum bürgerlicher Prägung, zeigen sich heute, im → kognitiven Kapitalismus, viele Überschneidungen zwischen Künstler_innen zugeschriebenen Eigenschaften und den Leitbildern eines zeitgenössischen Managements: «Autonomie, Spontaneität, Mobilität, Disponibilität, Kreativität, Plurikompetenz [...], die Fähigkeit, Netzwerke zu bilden» (Boltanski, Chiapello 2003, S.143 ff.). Kunstschaffende und sogenannte «Kreative» eignen sich entsprechend gut als Rollenmodelle für das unternehmerische Selbst (Loacker 2010). Sie gelten als improvisationsfähig (gerade auch im Umgang mit Unsicherheit und Armut), problemlösungsorientiert, neugierig, optimistisch und vor allem als selbstbeauftragt. Beständige persönliche Weiterentwicklung und Selbstveränderung gehören zum artikulierten positiven Selbstkonzept vieler Kulturschaffender (Loacker 2010, S.401).
Das grundsätzliche Problem bei der skepsisfreien Übernahme der Aufgabe, lebenslanges Lernen als internalisierten Wert durch Kulturvermittlung zu fördern, liegt wiederum in einer unwillkürlichen Unterstützung des Schaffens beziehungsweise der Rechtfertigung von Ungleichheit. Anstatt ökonomischer Deregulierung und steigender sozialer Unsicherheit mit Umverteilung zu begegnen, wird sie mit der Aufforderung an den Einzelnen, kreativ und flexibel zu sein und in das eigene Humankapital lebenslang weiter zu investieren, legitimiert.
Auf der pragmatischen Ebene soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass das glücklich selbstorganisierte Künstler_innensubjekt als Rollenmodell für zeitgemässe Erwerbstätigkeit eine fiktionale Figur ist. Künstler_innen und Kulturschaffende in Europa arbeiten mehrheitlich unter vergleichsweise harten ökonomischen Bedingungen. Viele von ihnen leben von der Hälfte (oder weniger) des offiziellen Existenzminimums und mit unzureichender oder ohne Absicherung für Krankheit und Alter (→ Lazzarato 2007). Diese Lebensumstände werden keineswegs von ihnen allen begrüsst und bereitwillig ins Selbstkonzept integriert: Es existiert organisierter Widerstand dagegen. Denn die Fähigkeit, neugierig zu sein und sich neu zu erfinden, muss nicht zwangsläufig in Anpassungsleistungen münden, sondern kann auch einfallsreiche politische Interventionen befördern (Lazzarato 2007). Als eines von vielen Beispielen hierfür soll das → GlobalProject / Coordination des intermittents et précaires d’Ile de-France genannt werden, dass 2003 gegründet wurde, um die Arbeitsbedingungen von im Bühnenbereich und im audiovisuellen Sektor Beschäftigten in Frankreich zu verändern. Oder das «Carrotworkers’ Collective» in England, in dem → prekär beschäftigte Kulturschaffende bewusst einen Schulterschluss mit anderen unterbezahlten und schlecht abgesicherten Berufsgruppen, etwa aus dem Pflege- oder Gastronomiebereich, unternehmen.
In den letzten Jahren ist auch Kulturvermittlung unter der Perspektive prekärer Arbeitsbedingungen im künstlerischen Feld thematisiert worden. Die Kunstvermittlerin, Künstlerin und Aktivistin Janna Graham berichtet in ihrem Artikel «Spanners in the Spectacle: Radical Research at the Frontline» (→ Graham 2010) im April 2010 von den teilweise mit künstlerischen Mitteln durchgeführten Streikaktionen und Erkundungen der eigenen Bedingungen von Vermittler_innen der Biennale Venedig, in Kooperation mit S.a.L.E. Docks und dem darin gehosteten, wiederum mit der Biennale verbundenen Projekt → Pirate Bay). In der Selbstbeschreibung von S.a.L.E. Docks heisst es: «S.a.L.E. is a permanent laboratory of piracy in the lagoon, a self managed situation active since 2007 in the struggle against all kind of privatization and exploitation of knowledge and creativity.» Doch sind widerständige Praktiken im Berufsfeld der Kulturvermittlung bis dato weniger häufig zu finden. Auch die in der Kulturvermittlung Beschäftigten (häufig selbst ausgebildete Künstler_innen) verkörpern die im Postfordismus hoch gewerteten Soft Skills: Sie verstehen sich von Berufs wegen als sozial kompetent, als gute Teamarbeiter_innen und Vernetzer_innen, als erfindungsreich im Umgang mit knappen Ressourcen, als neugierig und immer bereit, Neues zu lernen. Analog zur Figur des Künstlers als Rollenmodell ist Kulturvermittlung mit dem Versprechen verbunden, die kreativen Potentiale jedes Einzelnen nicht zuletzt für die Wirtschaft freizusetzen, «Arbeitskraft herzustellen, die flexibel und anpassungsfähig ist» (→ UNESCO 2010, Road Map).4 Und auch in der Vermittlung Tätige befinden sich zum grössten Teil in prekären Arbeitsverhältnissen. Doch sind sie – möglicherweise noch stärker als Künstler_innen – (noch) eine Gruppe mit einer vergleichsweise homogenen sozialen Herkunft. Sie entstammen mehrheitlich den «neuen Mittelschichten» (→ Sertl 2008), sie sind → Wissensarbeiter_innen. In ihrem Selbstverständnis ist der Gedanke, lebenslang zu lernen, eher mit den Verben «dürfen» und «können» als mit Zwang verknüpft. Aus dieser Sicht ist der Wunsch, auch bei den Teilnehmenden ihrer Angebote die Haltung nie enden wollender Lernbereitschaft zu fördern, wiederum einer Idee von «Gleichheit» im paradoxen Sinne geschuldet: Einerseits geht es darum, Privilegien zu teilen, Gleichberechtigung beim Zugang zur Bildungsressource Kultur herzustellen, andererseits aber auch, die Anderen dabei sich selbst ähnlich zu machen, sie davon zu überzeugen, dass die eigenen Ideale vom lernenden Subjekt die richtigen sind. Eine kritische Distanznahme zur Idee des lebenslangen Lernens würde für die Mehrheit der Kulturvermittler_innen daher gleichsam eine Distanznahme zu den eigenen Werten und Normen, mehr noch, zu den eigenen beruflichen Begründungen bedeuten. Genau diese Fähigkeit zur Selbstdistanz wäre aber ein Merkmal für pädagogische Professionalität.
Auch aus diesem Paradox (vergleichbar mit dem Paradox der Anerkennung aus dem → Text 2.FV) gibt es naturgemäss keinen einfachen Ausweg. Nicht zufällig werden auch die oben angeführten, gut begründeten Kritiken am lebenslangen Lernen und verwandten Konzepten in der Regel von Menschen geäussert, für die der Zugang zu Bildungsressourcen und das Wissen, wie man lernt, Selbstverständlichkeiten sind. Die Lösung kann also auch in diesem Fall nicht sein, aufzuhören, über Kulturvermittlung auch Freude am Lernen und der eigenen Weiterentwicklung zu vermitteln. Dies würde einfach nur bedeuten, privilegierte Positionen zu erhalten. Ein skeptisches, hinterfragendes Verhältnis zu scheinbar ausschliesslich positiv besetzten Konzepten wie dem lebenslangen Lernen im Sinne pädagogischer Reflexivität müsste jedoch zu einer veränderten und verändernden Praxis in der Kulturvermittlung führen. Es könnte dann nicht mehr ausschliesslich darum gehen, die Teilnehmenden für eine Sache zu begeistern und ihre Persönlichkeitsbildung «zu ihrem eigenen Besten» im Sinne eines versteckten Lehrplans zu beeinflussen. Stattdessen würden Momente der kritischen Distanznahme selbst zum Vermittlungsinhalt. Vielleicht könnten Materialien wie das → Alternative Curriculum), welches das Carrotworkers’ Collective für prekär beschäftigte Kulturarbeiter_innen als Handreichung entwickelt hat zum Anlass genommen werden, um in der Vermittlungssituation zu thematisieren, was es für die Teilnehmenden jeweils bedeutet, lernen zu dürfen/können/müssen. Von der Notwendigkeit lebenslanger individueller Optimierung im Zeichen des Wettbewerbs weg zu einer Vorstellung von lebensverlängerndem Lernen zu gelangen, welche die Gemeinschaft in den Blick nimmt und keine Verlierer akzeptiert, könnte ein Lernziel für die Kulturvermittlung sein.
Welche Haltung man auch immer einnehmen möchte – es sollte durch die hier erfolgte Problembeschreibung deutlich geworden sein, dass die Notwendigkeit besteht, sich als Kulturvermittler_in in Bezug auf die Ziele, die man mit der Arbeit verfolgt, zu positionieren und diese möglichst auch gegenüber den Teilnehmenden transparent zu machen – immer vorausgesetzt, man folgt den Autor_innen des Handbuchs «Museen und lebenslanges Lernen» in ihrem Anspruch, diesen Teilnehmenden auf Augenhöhe zu begegnen.
1 Das Handbuch ging aus dem zweijährigen, von der Europäischen Kommission finanzierten Projekt Lifelong Museum Learning (LLML) hervor, das im Rahmen des Socrates Grundtvig Programms von Oktober 2004 bis Dezember 2006 gefördert wurde.
2 Die zunehmende Verlagerung von Regierungstechniken in die Selbstregulierungskapazitäten des Individuums bildet inzwischen ein umfassendes Untersuchungsfeld innerhalb der Sozialwissenschaften: die Gouvernementalitätsstudien.
3 Die Autorinnen beziehen sich mit dieser Aufzählung auf die von Eilean Hooper Greenhill entwickelten «Generic Learning Outcomes», ein Raster zur Identifizierung von Lernergebnissen beim Museumsbesuch. → http://www.inspiringlearning.com/toolstemplates/ genericlearning/index.html [5.9.2012] und Hooper Greenhill 2007, → siehe Text 7.FV.
4 «21st Century societies are increasingly demanding workforces that are creative, flexible, adaptable and innovative and education systems need to evolve with these shifting conditionS.Arts Education equips learners with these skills […]» (UNESCO 2010).
Literatur und Links
Literatur:- Atzmüller, Roland: «Die Krise lernen – Neuzusammensetzung des Arbeitsvermögens im postfordistischen Kapitalismus», in: Sandoval, Marisol, et al.: Bildung. MACHT. Gesellschaft, Münster: Westfälisches Dampfboot, 2011, S.117–136
- Boltanski, Luc; Chiapello Ève: Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz: UKV, 2003
- Bröckling, Ulrich: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt: Suhrkamp, 2007
- Deutscher Museumsbund (Hg.) (2008): Bürgerschaftliches Engagement im Museum [1.5.2012]; → MFE070401.pdf
- Freire, Paulo: Erziehung als Praxis der Freiheit, Stuttgart: Kreuz, 1974
- Gibbs, Kirsten, et al. (Hg.): Lifelong Learning in Museums – A European Handbook, Ferrara, Edisai, 2007
- Graham, Janna: «Spanners in the Spectacle: Radical Research at the Front Lines», in: Fuse Magazine, April 2010 [10.10.2012]; → MFV0704.pdf
- Hooper Greenhill, Eilean: Museums and Education. Purpose, Pedagogy, Performance, New York: Routledge, 2007
- Lazzarato, Maurizio: «Die Missgeschicke der ‹Künstlerkritik› und der kulturellen Beschäftigung», in: transversal - eipcp multilingual webjournal, 2007 [30.10.2012]; → MFV0302.pdf
- Merkens, Andreas: «Neoliberalismus, passive Revolution und Umbau des Bildungswesens. Zur Hegemonie postfordistischer Bildung», in: Meyer-Siebert, Jutta, et al. (Hg.): Die Unruhe des Denkens nutzen. Emanzipatorische Standpunkte im Neoliberalismus, Hamburg: Argument, 2002, S.171–182 [21.2.2013]; → MFV0309.pdf
- Quenzel, Gudrun; Hurrelmann, Klaus (Hg.): Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011
- Ribolits, Erich: «Flexibilität», in: Dzierzbicka/Schirlbauer (Hg.): Pädagogisches Glossar der Gegenwart, Wien: Löcker-Verlag, 2006, S.120–127 [12.10.2012]; → MFV0310.pdf
- Sennett, Richard: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin: Berlin-Verlag, 1998
- Sertl, Michael: «Offene Lernformen bevorzugen einseitig Mittelschichtkinder! Eine Warnung im Geiste von Basil Bernstein», in: Heinrich, Martin; Prexl-Krausz, Ulrike (Hg.): Eigene Lernwege – Quo vadis? Eine Spurensuche nach «neuen Lernfomen» in Schulpraxis und LehrerInnenbildung, Wien/Münster: LIT-Verlag, 2007, S.79–97 [21.2.2013]; → MFV0308.pdf
- Sertl, Michael: «Individualisierung als Imperativ? Soziologische Skizzen zur Individualisierung des Unterrichts», in: IDE 3/2008, S.7–16, Innsbruck: StudienVerlag [21.2.2013]; → MFV0306.pdf
- UNESCO (Hg): Seoul Agenda. Goals for the Development of Arts Education, Seoul, 2010 [22.2.2013]; → MFV0305.pdf
Links:
- Carrotworkers Collective, Alternative Curriculum [14.10.2012]
- Coordination des intermittents et précaires d’Ile-de-France, Paris [7.9.2012]
- Pirate Bay [7.9.2012]
- UNESCO, World Conference on Art Education, Lisbon 2006/Seoul 2010, Roadmap [30.4.2012]