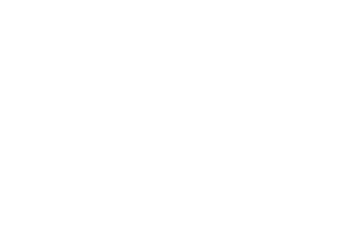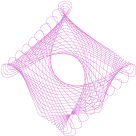Text als PDF-Download ↓
Für Eilige
6.4 Legitimation: Kulturvermittlung zur Inklusion
Ähnlich wie die Forderung, durch Steuergelder finanzierte Kunst für alle Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen, kritisiert auch das Konzept der Inklusion die Tatsache, dass Institutionen der Hochkultur grosse Teile der Gesellschaft ausschliessen. Diese sollen durch Vermittlungsangebote an das vorhandene Kunst- und Kulturangebot herangeführt und auf diese Weise zur kulturellen Teilhabe motiviert werden. Geleitet ist dieses Argument weniger vom Anspruch der Steuergerechtigkeit als vom ethischen Grundsatz der Gleichbehandlung und entsprechenden Demokratisierungsgedanken. Die Idee der Inklusion bezieht sich dabei konkret auf gesellschaftliche Gruppen, die aufgrund sozialer Ungleichheit wenig Zugang zu Bildung und Wohlstand haben oder in anderer Weise von den Bedürfnis- und Handlungsgewohnheiten der Mehrheitsgesellschaft abweichen, zum Beispiel aufgrund von Behinderungen. Kulturvermittlung wird hier als eine Möglichkeit gesehen, die ungleiche Verteilung von Ressourcen über die Ermöglichung kultureller Teilhabe auszugleichen. So weist beispielsweise eine Verlautbarung des deutschen Projektes
→ Tanz in Schulen darauf hin, welchen durch soziale Ungleichheit verursachten Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen durch die aktive Beschäftigung mit Tanz entgegengewirkt werden soll: «Tanz ist nonverbal und hilfreich für die Integration von Kindern unterschiedlicher Herkunft […] Tanz fördert die Persönlichkeitsbildung und unterstützt die Entwicklung von Identität durch das Erleben des ‹Körper-ICH›. Tanz als künstlerische Kommunikations- und Ausdrucksform fördert: Bewegungsvielfalt, Bewegungsqualität, Körperwahrnehmung, Körperbewusstsein, Vorstellungsfähigkeit, Bewegungsphantasie, Gestaltungsfähigkeit und eigenschöpferisches Handeln, Persönlichkeitsbildung, soziale Kompetenzen, interdisziplinäres Arbeiten.»
Problematisch am Inklusionsgedanken ist, dass er Kultur und Institutionen als unveränderliche Grösse voraussetzt, in die bisher Ausgeschlossene einbezogen werden sollen. Selten wird dabei der gesellschaftliche Kontext, der zur Ungleichbehandlung erst führt, mit reflektiert und in die Arbeit an Veränderungen einbezogen. Zudem wird einseitig definiert, wer es nötig hat, einbezogen zu werden, und was die Norm ist, in die einbezogen werden soll. Diese Vorstellung kann als
→ paternalistisch, also als gutmeinend-bevormundend angesehen werden. Es besteht die Gefahr, dass Menschen auf ihre vermeintlichen Defizite festgelegt und darin «gleichgemacht» werden (
→ Dannenbeck, Dorrance 2009).