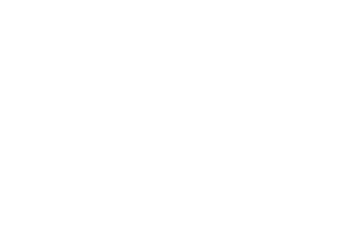Arbeiten in Spannungsverhältnissen 2:
Adressierung und das Paradox der Anerkennung
«Wie jedes soziale Projekt muss das Anerkennungsprojekt überhaupt, konkrete Projekte der Anerkennung im Einzelnen in den spezifischen Weisen verstanden werden, in denen sie sich zu Systemen der Macht verhalten. Sobald soziale Anerkennung als Forderung oder Vorhabe konkret wird, schließt sie aus.» (Mecheril 2000)
Wie im Text 1.FV beschrieben, ist eine der historisch gewachsenen Motivationen für Kulturvermittlung die Forderung, dass die Künste als Allgemeingut allen Mitgliedern einer Gesellschaft zugänglich sein sollen. In den letzten Jahrzehnten ist der Druck auf öffentlich finanzierte Kultureinrichtungen gewachsen, ihren Erfolg über Besucher_innenzahlen und über ein plural zusammengesetztes Publikum zu belegen. Gleichzeitig verstärkt sich die Konkurrenz mit anderen Angeboten des Freizeit- und des Bildungssektors. Diese Faktoren führen neben anderen dazu, dass Kultureinrichtungen – auch solche, für die der Gedanke einer Demokratisierung der Künste nicht unbedingt prioritär ist – sich → besucher_innen-orientiert ausrichten und über Vermittlungsangebote für spezifische Adressat_innen versuchen, ihr Publikum zu erweitern. Dabei werden gesellschaftliche Gruppen anvisiert, die nicht zum Stammpublikum der Institutionen gehören und von denen angenommen wird, dass sie einer aktiven Einladung bedürfen. Es handelt sich um Teile der Bevölkerung, die über vergleichsweise wenig → kulturelles und ökonomisches Kapital verfügen und die daher von einer privilegierten Position aus als «benachteiligt» oder «bildungsfern» gelten.
Die Adressierung solcher Gruppen durch die Kulturinstitutionen unterliegt einem Spannungsverhältnis, das der Migrationspädagoge Paul Mecheril mit Bezug auf Hegel «Paradox der Anerkennung» nennt (→ Mecheril 2000). Einerseits erfolgt die Ansprache zumindest augenscheinlich mit dem Ziel, Gleichberechtigung her- oder zumindest ihre Möglichkeit in den Raum zu stellen. Andererseits aber bedingt Adressierung eine Identifizierung und damit eine Festschreibung der Angesprochenen als Andere, und eben gerade nicht als Gleiche. Dabei sind die jeweils vorgenommenen Identifizierungen weder zufällig noch neutral, sondern von den Perspektiven und Interessen der Einladenden geformt. Sie haben nicht nur die Funktion, das Andere herzustellen, sondern auch, das Eigene als angestrebte Norm zu bestätigen. Bei der Bezeichnung «bildungsfern» zum Beispiel stellt sich die Frage nach dem Bildungsverständnis, das es erlaubt, bestimmte Personen als fern davon zu verorten. In der Debatte um Kulturnutzung taucht dieser Begriff auf und meint (zumeist unausgesprochen) die fehlende Affinität zum anerkannten, bürgerlichen Bildungskanon.1 «Bildungsfern» wird also als Fremdbezeichnung von denjenigen verwendet, die davon ausgehen, dass die Bildung, über die sie verfügen, auch für andere gut ist. So betrachtet scheint die angestrebte «Gleichheit» im Kontext dieser und auch vieler anderer Adressierungen weniger Gleichberechtigung zu meinen als das Recht (oder die Pflicht?), sich denen, welche die Einladung aussprechen, anzugleichen. In der Diskussion um Zugang zum Arbeitsmarkt bezeichnet «bildungsfern» das Fehlen von zertifizierter Ausbildung und von Schulabschlüssen. Der Bildungswissenschafter Erich Ribolits wirft demgegenüber ein, dass «Bildung» gerade nicht Arbeitsmarktkompatibilität meine, und schlägt vor, darunter stattdessen die «Befähigung […], sich gegenüber den aus den aktuellen Machtverhältnissen resultierenden Systemzwängen der Gesellschaft behaupten zu können» zu verstehen. In diesem Sinne Gebildete würden «sich gegen die totalitäre Ausrichtung des Lebens an einer möglichst erfolgreichen Performance in Arbeit und Konsum stellen» und «die Natur nicht bloß als Ausbeutungsobjekt und Mitmenschen nicht nur als Konkurrenten wahrnehmen» (→ Ribolits 2011). Einerseits, so Ribolits, müsse aus dieser Perspektive ein Grossteil der Bevölkerung als «bildungsfern» gelten. Andererseits fänden sich entsprechende Haltungen in verschiedensten Teilen der Gesellschaft und seien kausal weder an hohe Schul- oder Berufsabschlüsse noch an bürgerliche Kulturvorstellungen gekoppelt. Mit diesem Bildungskonzept liessen sich möglicherweise gerade auch Wissen und Können von Menschen mit wenig kulturellem und ökonomischem Kapital (z.B. ein dadurch forciertes Improvisations- oder Subversionsvermögen) als Merkmale einer Bildungselite interpretieren.
Während «Bildungsferne» zwar häufig zur Identifizierung, aber nie explizit zur Ansprache von Zielgruppen verwendet wird, weil sich davon wohl kaum jemand positiv angesprochen fühlen würde, gilt dies nicht für die immer häufiger auftauchende, um nichts weniger problematische Adressierung «Menschen mit Migrationshintergrund». In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts (genauer: seit dem Attentat auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001) ist die Frage nach der Positionierung und den Handlungsmaximen von Kulturinstitutionen in der → Migrationsgesellschaft zentral geworden, wie sich an einer grossen Zahl von Projekten, Studien, Handreichungen und Konferenzen zeigt.2 Die von Akteur_innen der Kulturvermittlung – nicht zuletzt in Reaktion auf förderpolitische Vorgaben – vorgenommene Adressierung «Migrationshintergrund» verfehlt dabei die enorme Pluralität und Komplexität von Identitätskonstruktionen in Einwanderungsgesellschaften, weil sie sich vornehmlich an ganz bestimmte, ethnisch und national als «Andere» markierte Gruppen wendet. Konkret: Durch Kulturvermittlungsangebote sollen nicht etwa gutverdienende → Expats in das Kunstgeschehen hineingezogen werden, sondern eben als «mit Migrationshintergrund» identifizierte «Bildungsferne». Mecheril und andere Autor_innen machen deutlich, dass es sich bei dieser Form der Identifizierung um eine Kulturalisierung von strukturellen und sozialen Missständen handelt. Die durch die Strukturen der → Mehrheitsgesellschaft verursachten Effekte von sozialer, rechtlicher und politischer Ungleichbehandlung werden nicht thematisiert; stattdessen wird die zuvor festgeschriebene kulturelle Differenz der Eingeladenen selbst zum wichtigsten Erklärungsmuster für ihre Abwesenheit in den Institutionen. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich bei den Adressierten zunehmend Widerstand gegen die Adressierung als «Mimimi» (Mysorekar 2007) regt. Beispielsweise wurde im Herbst 2011 von der → Tiroler Kulturinitative), ein Workshop unter dem Titel «Antirassismus und Kulturarbeit» angeboten:3
«Mittlerweile ist in ‹kritischen› bzw. antirassistischen Kontexten mehr oder weniger Konsens, dass sich die öffentlichen Migrationsdebatten von den Migrant_innen auf die Probleme der Gesellschaft verschieben sollen: nicht über ‹bildungsferne› Migrant_innen reden, sondern über die Misere und rassistischen Strukturen des Bildungssystems; nicht über Migrant_innen, die das Sozialsystem ausnutzen, sondern über Mechanismen, die ausgrenzend wirken etc.
Auch hat sich die Migrationsdebatte stark auf Migrant_innen aus muslimischen Ländern verschoben: War vor ein paar Jahren noch die Rede von Migrant_innen mit türkischen Eltern bzw. Großeltern, ist jetzt die Rede von muslimischen Migrant_innen.
Fragen, ausgehend vom Umstand, dass Kulturarbeit diskursbildend ist:
- Welchen Beitrag leistet die freie Kulturarbeit in der Migrationsdebatte?
- Wie kann antirassistische Kulturarbeit geleistet werden, ohne auf die aktuelle Migrationsdebatte einzugehen?
- Können z.B. Förderanträge gestellt werden, ohne Teil dieser Debatte zu werden?
- Geht es auch ohne ‹Migrant›*? Oder: AntiRa-Arbeit abseits von identitären Zuschreibungen.
- Wie wird in der freien Kulturarbeit mit Rassismen innerhalb und außerhalb der eigenen Arbeit umgegangen?
- Hat Antirassismusarbeit etwas mit Ressourcenverteilung zu tun?
- Nach welchen Kriterien wird Rassismus identifiziert?
- Nach welchen Kriterien wird Anti-Rassismus identifiziert?»
1 Eines von vielen Beispielen aus der Entstehungszeit dieses Textes: «So bieten mittlerweile einige deutschsprachige Musikhochschulen Aus- und Weiterbildungsangebote zur Musikvermittlung an, die auf die unterschiedlichen Arbeitsbereiche für Zielgruppen von jung bis alt, von ‹einheimisch› bis ‹postmigrantisch› und von bildungsnah bis bildungsfern vorbereiten sollen» (Wimmer 2012).
2 Einige Beispiele: Tagungen: «inter.kultur.pädagogik», Berlin 2003; «Interkulturelle Bildung – Ein Weg zur Integration?», Bonn 2007; «Migration in Museums: Narratives of Diversity in Europe», Berlin 2008; «Stadt Museum Migration», Dortmund 2009; «MigrantInnen im Museum», Linz 2009; «Interkultur. Kunstpädagogik Remixed», Nürnberg 2012; «Forschung /Entwicklung: Creating Belonging», Zürcher Hochschule der Künste, gefördert von SNF 2008–2009; «Migration Design. Codes, Identitäten, Integrationen», Zürcher Hochschule der Künste, gefördert von KTI 2008–2010; «Museums as Places for Intercultural Dialogue», EU-Projekt 2007–2009; «Der Kunstcode – Kunstschulen im Interkulturellen Dialog», Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen e. V. (BJKE), gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 2005–2008; «Museum und Migration: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund als Zielgruppe von Museen», Linzer Institut für qualitative Analysen (LIquA), im Auftrag der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich, Abteilung Soziales und Institut für Kunst und Volkskultur 2009–2010. Publikationen und Handreichungen: Handreichung zum Schweizerischen Museumstag 2010; Allmanritter, Siebenhaar 2010; Zentrum für Audience Development der FU Berlin: Migranten als Publika von öffentlichen deutschen Kulturinstitutionen – Der aktuelle Status Quo aus Sicht der Angebotsseite, 2009, → http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/zad/news/zadstudie.html [16.4.2012]
3 Der Workshop wurde von Vlatka Frketic geleitet.
4 Mit «Mehrheitsangehörige» werden in diesem Text Schweizer Bürger_innen unabhängig von der Sprachregion bezeichnet.
5 «Wenn man die Begriffe des Ewigweiblichen, der Schwarzen Seele, des Jüdischen Charakters ablehnt, so heißt das nicht leugnen, dass es heute Juden, Schwarze und Frauen gibt: Diese Verneinung bedeutet für die Betroffenen keine Befreiung, sondern nur eine unendliche Ausflucht» (Beauvoir 1968, S.9).
Literatur und Links
Der Text basiert in Teilen auf folgendem bereits erschienenen Beitrag: Weitere Literatur:- Almanritter, Vera; Siebenhaar, Klaus (Hg.): Kultur mit allen! Wie öffentliche deutsche Kultureinrichtungen Migranten als Publikum gewinnen, Berlin: B & S Siebenhaar, 2010
- Arts Council, England: A practical guide to working with arts ambassadors, London: Arts Council, 2003 [12.10.2012]; → MFV0209.pdf
- Castro Varela, Maria do Mar: Interkulturelle Vielfalt, Wahrnehmung und Selbstreflexion aus psychologischer Sicht, (o.D.) [12.10.2012]; → MFV0210.pdf
- Gülec, Ayse et al.: Kunstvermittlung 1: Arbeit mit dem Publikum, Öffnung der Institution, Zürich: Diaphanes 2009
- Kilomba, Grada: «Wo kommst du her?», in: Heinrich Böll Stiftung, Dossier Schwarze Community in Deutschland (o.D.) [16.8.2012]; → MFV0208.pdf
- Mecheril, Paul: Anerkennung des Anderen als Leitperspektive Interkultureller Pädagogik? Perspektiven und Paradoxien, Vortragsmanuskript zum interkulturellen Workshop des IDA-NRW 2000 [14.10.2012]; → MFV0201.pdf
- Mysorekar, Sheila: «Guess my Genes – Von Mischlingen, MiMiMis und Multiracials», in: Kien Nghi Ha et al. (Hg.): re/visionen – Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland, Münster: Unrast, 2007, S.161–170
- Ribolits, Erich: «Wer bitte ist hier bildungsfern? Warum das Offensichtliche zugleich das Falsche ist», in: HLZ, Zeitschrift der GEW Hessen, Nr. 9/10, 2011 [12.10.2012]; → MFV0202.pdf
- Spivak, Gayatri Chakravorty: «Can the Subaltern Speak?», in: Nelson, C.; Grossberg L. (Hg.), Marxism and the Interpretation of Culture, Basingstoke: Macmillan, 1988, S.271–313
- Terkessidis, Mark: «Im Migrationshintergrund», in: der freitag 14.1.2011 [15.2.2013]; → MFV0206.pdf
- Wimmer, Constanze: «Kammermusik-Collage oder Babykonzert – von den vielfältigen Wegen der Musikvermittlung», in: KM. Das Monatsmagazin von Kulturmanagement Network. Kultur und Management im Dialog, Nr. 67, Mai 2012, S.15 [25.8.2012]; → MFV0211.pdf
- Winter Saylir, Sara: «‹Wo kommst du her?› – ‹Aus Mutti›. Antirassismustraining für Europa», in: WOZ Die Wochenzeitung, Nr. 31, 14.8.2011; → MFV0207.pdf