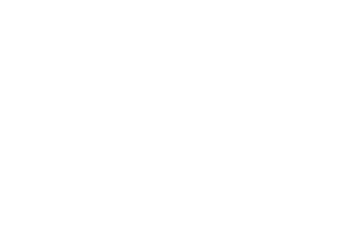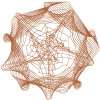Text als PDF-Download ↓
Für Verweilende
Arbeiten in Spannungsverhältnissen 8:
Qualitätsevaluation in der Kulturvermittlung zwischen Selbstreflexion, Ermächtigung und Anpassung
«Who has the right to ask whom what questions; who has the right to answer; who has
the right to see what; who has the right to say what; who has the right to speak for whom?» (Smith 2011)
Am Ende des Textes über
→ Kritiken am Qualitätsmanagement in der Kulturvermittlung wurde angedeutet, dass Kriterien zur Bestimmung von Qualität zwangsläufig eine normative Dimension haben. Hierzu sollen im Folgenden zwei Beispiele angeführt werden. In ihrer internationalen Studie zur Qualität in der Musikvermittlung und Konzertpädagogik führt Constanze Wimmer die Prozessqualität als eine von drei
→ Qualitätsdimensionen ein (
→ Wimmer 2010). Zu dieser schreibt sie: «Sie bestimmt die künstlerische und pädagogische Konzeption und ermöglicht partizipative Ansätze für das Publikum und die Teilnehmer» (Wimmer 2010, S.10). In ihren weiteren Ausführungen wird ein hoher Grad von Partizipation (z.B. im Sinne von aktiver musikalischer Beteiligung Jugendlicher oder auch von Mitbestimmung von Lehrpersonen in der Planungsphase eines Vermittlungsprojektes) als Indikator für eine hohe Qualität der Musikvermittlung bestimmt. Man mag mit diesem Indikator einverstanden sein oder nicht – fest steht, dass er nicht selbstverständlich, gleichermassen natürlich gegeben ist, sondern auf Zielvorstellungen der Autorin in Bezug auf Musikvermittlung verweist. In der Studie wird diese Positionierung begründet, beispielsweise durch Ausführungen über die positiven Effekte «kultureller Partizipation» von Kindern und Jugendlichen auf ihre Haltung gegenüber ernster Musik oder über die Vorreiterrolle Grossbritanniens in der Kulturvermittlung, an dessen Modellen sich viele kontinentaleuropäische Projekte orientierten. Durch die Begründungen wiederum wird deutlich, dass den Qualitätskriterien ein implizites, für selbstverständlich genommenes Konzept von Kulturvermittlung mit
→ reproduktiver Funktion zugrunde liegt: Es geht vor allem darum, durch Musikvermittlung die zukünftigen Publikumsgenerationen heranzubilden. (Die in der Publikation besprochenen Fallstudien verweisen darüber hinaus neben der kulturellen Teilhabe auch auf die Idee der Kultur als Werkzeug zur
→ Veränderung sozialer Verhältnisse als Legitimation für Kulturvermittlung.)
Der Deutsche Museumsbund und der Bundesverband Museumspädagogik haben in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Verband der Kulturvermittler_innen im Museums- und Ausstellungswesen und mit mediamus, dem Schweizerischen Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im Museum im Jahr 2008 eine Broschüre mit dem Titel
→ Qualitätskriterien für Museen: Bildungs- und Vermittlungsarbeit herausgegeben. Sie liefert nicht nur eine Handreichung zur Frage nach der Qualität, sondern gleichzeitig einen Abriss des Berufsfeldes der Kulturvermittlung. Zunächst werden die Aufgaben und Zuständigkeiten der Vermittlung im institutionellen Gefüge Museum definiert. Es folgen Festlegungen zu Inhalten,
→ Zielgruppen und Methoden der Vermittlung, sowie zur Qualifikation des Personals und den notwendigen Rahmenbedingungen für eine qualitätsvolle Vermittlungsarbeit. Pro Themenfeld findet sich eine Qualitätsdefinition. Diese Definitionen sind allgemein gehalten und changieren zwischen der Beschreibung der Tätigkeit und der Formulierung von Zielvorstellungen und Qualitätsansprüchen.
So heisst es beispielsweise zum Thema «Methoden»: «Qualitätvolle Bildungs- und Vermittlungsarbeit bedient sich einer Vielfalt von Methoden, um die Begegnung mit den Originalen und Ausstellungsinhalten und mit der Institution Museum generell zu erleichtern. Sie aktiviert und fördert damit die Erkenntnis- und Wahrnehmungsmöglichkeiten der Besucher/innen und leitet sie auf vielfältige Art und Weise zum selbständigen Lernen mit allen Sinnen an.» Oder bei «Zielgruppen»: «Vermittler/innen arbeiten für alle und mit allen Besuchern/innen eines Museums. Diese haben jeweils unterschiedliche Bedürfnisse. Die Mitarbeiter/innen für Museumspädagogik entwickeln Angebote für alle Gruppen des Museumspublikums und für potentiell neue Besucher/innen, um möglichst vielen die Teilhabe an kultureller Bildung im Museum zu ermöglichen.» Im weiteren Verlauf dieses Kapitels erfolgt eine besondere Betonung des Bemühens um
→ Barrierefreiheit als Qualitätsindikator.
Obwohl im Vorwort der Broschüre betont wird, dass sie als Impuls zur weiteren Diskussion über qualitätsvolle Vermittlungsarbeit verstanden werden möchte, erfolgt in ihr keine transparente Positionierung. Es fehlt eine Begründung, warum aus Sicht der Autor_innen die affirmative und reproduktive Funktion von Vermittlung für das gesamte Berufsfeld leitend sein sollte. Die Funktionen werden in der Handreichung daher normalisiert, als selbstverständlich und voraussetzungslos richtig eingeführt. Wie unter anderem im Text 6.FV, aber auch in den anderen Kapiteln argumentiert, kann es aber ganz andere Ziele der Vermittlung geben als zum Beispiel das Erleichtern der Begegnung mit Originalen und der Institution für möglichst viele. Entsprechend kann es andere
→ Kriterien zur Beurteilung von Kulturvermittlung geben. Ein Transparentmachen und vor allem eine Kontextualisierung der Zielvorstellungen wäre aber ein Indikator für das Anliegen, einen Beitrag zu einer Debatte zu leisten. Stattdessen wird in dem Text auf den von den Verbänden gemeinsam gestalteten Erarbeitungsprozess sowie auf die Museumsdefinition des ICOM (International Council of Museums) als Grundlage für die Kriterien der Broschüre verwiesen. Dies lässt zumindest die Vermutung zu, dass vielleicht doch eher verbindliche Definitionen zur Verfügung gestellt werden sollen und es damit um das Behaupten von Definitionsmacht geht. Nicht zuletzt ist der Leitfaden als Beitrag im Ringen um offizielle Anerkennung eines traditionell marginalisierten Praxisfeldes als ernstzunehmende Profession im Sinne eines Berufsbekenntnisses zu interpretieren.
Für eine hegemoniekritische Kulturvermittlung ist dieser Text aufgrund der
→ Naturalisierung seiner Argumente problematisch. Ihr Anspruch wäre es, sich grundsätzlich reflexiv zur Normativität von Kriterien und Zielen – auch zu den eigenen – zu verhalten und sie auf die ihnen innewohnenden Machtverhältnisse zu befragen. Sie beschäftigt sich mit den Fragen, wie von aussen (und auch und gerade vom eigenen Arbeitsfeld) gesetzte Anforderungen an Qualität mit den
→ eigenen Kriterien einer kritischen Praxis und mit den existierenden Rahmenbedingungen konstruktiv zu vereinbaren seien, wie die von aussen gesetzten Kriterien und Rahmenbedingungen im eigenen Sinne zu beeinflussen wären. Und, falls sich dies als unmöglich erweist, wie ihnen gegenüber allenfalls Widerstand geleistet werden könnte. Darüber hinaus reflektiert sie die Art der sozialen Beziehungen, welche durch den vergleichsweise neuen Imperativ der Qualitätsmessung entstehen und deren Auswirkungen auf die Verhältnisse und Handlungslogiken im Arbeitsfeld. Qualitätsmessung impliziert soziale Beziehungen, die massgeblich von Momenten der Lieferung von Ergebnissen, der Überprüfung und Beurteilung und des Erbringens von Beweisen charakterisiert sind. Angesichts dessen drängen sich mehrere Fragen auf: Ist ein überprüfendes, beweisendes und ergebnisorientiertes Verhältnis dasjenige, welches wir uns für den Umgang miteinander, für die Gestaltung von Beziehungen und Handlungen im Arbeitsfeld der Kulturvermittlung wünschen? Und: «Wer hat [in diesem Rahmen, Anmerkung CM] das Recht, wem welche Fragen zu stellen? Wer hat das Recht, zu antworten? Wer hat das Recht, was zu sehen; wer hat das Recht, was zu sagen; wer hat das Recht, für wen zu sprechen?» (Übersetzung des Eingangszitats zu diesem Text).
Ein Beispiel für ein Nachdenken über Qualität in der Kulturvermittlung in dieser Perspektive ist eine im März 2012 veröffentlichte Erklärung aus der Theatervermittlung. Im März 2012 fand am Deutschen Theater in Berlin zum zweiten Mal
→ Was geht?, ein Symposium des Arbeitskreises Theaterpädagogik der Berliner Bühnen und des Instituts für Theaterpädagogik der Universität der Künste Berlin, statt. Im Anschluss wurde unter dem Titel «Wollen Brauchen Können» eine Erklärung zu Wissen und Können, Zielen und Bedürfnissen von Theaterpädagogik an Theatern veröffentlicht . Darin wird betont, dass Theatervermittler_innen insbesondere «durch Perspektivenwechsel eine produktive Distanz einnehmen können», einen «geschützten Spiel-, Denk- und Erfahrungsraum eröffnen», und «Widerstände und Störungen produktiv machen». Zu den Zielen gehört dem Papier zu Folge «nicht (nur) die Theaterzuschauer von morgen kulturell bilden (‹beschaffen›), sondern die von heute in Kontakt mit der Kunstform Theater und mit Künstlern bringen» sowie «eine künstlerisch orientierte Theaterpädagogik. Es geht neben der Vermittlung von Inhalten und Wissen, vor allem darum, künstlerisches Wissen gemeinsam zu generieren und darzustellen». Im dritten Teil des Papiers «Wollen Brauchen Können» wird angeführt, was das Arbeitsfeld benötigt, um die zuvor formulierten Ansprüche zu verwirklichen. Dazu gehören «die Durchsetzung des Profils und Arbeitsfeldes des/der Theaterpädagogen/in den künstlerischen Leitungen und Intendanzen in all seiner Breite», «künstlerische Autonomie und einen eigenen Etat für theaterpädagogische Programme» oder eine «inhaltliche, künstlerische, qualitative Bewertung unserer Arbeit». Bei letzterem Punkt wird explizit Kritik an den Zugängen zur Evaluation geübt, die gegenwärtig in den verschiedenen Bereichen der Kulturvermittlung auf dem Vormarsch sind: «Unsere Arbeit lässt sich nicht quantitativ bemessen und bewerten, sie spiegelt sich nicht wider in der Anzahl stattgefundener Veranstaltungen. Es darf nicht darum gehen, Workshops, Publikumsgespräche, Theaterclubproben, Projektarbeiten und die Anzahl der daran Beteiligten zu summieren und diese Zahl X sich selbst und der Politik als erfolgreiche kulturelle Bildung zu verkaufen.»
Durch die Verknüpfung der drei Aspekte Potentiale, Ziele und Bedarfe suchen die Verfasser einen Zugang zu der Frage nach Qualität in der Theatervermittlung jenseits der Forderung, diese durch äussere Instanzen messbar, beweisbar und überprüfbar zu machen. Hier wird der Versuch unternommen, eigene Arbeitsprinzipien zu formulieren und damit das spezifische Potential sowie Ziele und Motive einer an Theaterkunst ausgerichteten Vermittlungsarbeit ohne Verweis auf autorisierende Instanzen selbst zu bestimmen. Damit einher geht eine Selbstverpflichtung des Berufsstandes, auf der Basis einer kontinuierlich geführten fachlichen Diskussion einen qualitativen und ethischen Rahmen für das Arbeitsfeld zu entwickeln und diese beiden Dimensionen nicht getrennt voneinander zu denken. Ein Jahr zuvor, am 31. März 2011, wurde in Antalya (TR) durch die Verbände
→ BAG Spiel und Theater und ÇDD (Çağdaş Drama Derneği) ein internationales Übereinkommen über das Verhalten und zur Ethik von Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen veröffentlicht. Zusammengelesen können die beiden Dokumente als Referenz für diesen Entwicklungsprozess betrachtet werden, wobei sie beide weiter diskutiert und weitergeschrieben werden müssen.
Grossbritannien nimmt nicht nur in der Entwicklung von Modellen für die Kulturvermittlung, sondern auch von deren Qualitätsmessungsverfahren eine Vorreiterrolle ein. Hier werden gegenwärtig alternative Herangehensweisen für die Evaluation entwickelt. Dabei kommen Impulse bislang vornehmlich aus dem Feld der «Community Arts» oder «Socially Engaged Art», also der (meist von öffentlichen Fördereinrichtungen oder Stiftungen beauftragten) Zusammenarbeit von Künstler_innen mit unterschiedlichen Öffentlichkeiten, meist zur
→ gemeinsamen Bearbeitung von gesellschaftlichen Problemstellungen. Dies ist wenig überraschend, da solche Projekte in der Regel unter einer besonderen Beweislast in Bezug auf Qualität und Wirkung stehen, sich in ihnen unterschiedlichste, häufig divergierende Interessen kreuzen, wobei die Macht dabei ungleich verteilt ist. Um die Möglichkeit eines reflektierten und
→ selbstermächtigenden Umgangs mit diesen unterschiedlichen Interessen zu eröffnen, entwickelte beispielsweise die englische Künstlerin Hanna Hull 2012 in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur_innen sechs online abrufbare
→ Toolkits für die Reflexion der Arbeit bei künstlerischen Projekten im Kontext von Psychiatrie, Rehabilitation und Strafsystem. Eines davon trägt den Titel
→ Criticality and Evaluation in a Culture of Optimism und bietet praktische Anregungen für eine Selbstevaluation als kritische Praxis der in den Projekten beteiligten Akteure. Dazu gehören Übungen zur Beschreibung der verschiedenen Interessen, die in die Erstellung einer Evaluation hineinwirken, und zu der Frage, wem die Entwicklung einer kritischen Beschreibung, welche die Widersprüche und Komplexitäten der Arbeit und ihrer Bedingungen hervorhebt, jeweils nützen oder schaden würde. Oder eine Übung zur Beschreibung und Kommunikation produktiver Fehler sowie zur Überprüfung, ob die Akteur_innen mit den Begriffen, die für die Evaluation von Auftraggeber_innenseite nahegelegt werden, zufrieden sind, oder ob andere Begriffe zu einer Selbstbeschreibung geeigneter wären. Ein weiteres Beispiel für einen hegemoniekritischen Umgang mit Evaluationsprozessen ist die Praxisforschung der Kuratorin, Künstlerin und Kulturwissenschafterin
→ Sophie Hope, die seit 2005 als Evaluatorin im Bereich Kulturvermittlung und Community Arts tätig ist. In ihrem Buch «Participating in the wrong way?» (Hope 2011) dokumentiert sie ihrerseits Versuche
→ to reclaim evaluation as a critical practice. Im Projekt «Critical Friends» teilte sie die Verantwortung für die Evaluation von Community-Arts-Projekten im Londoner Stadtteil North Greenwich in den Jahren 2008 bis 2010 mit einer Gruppe von Bewohner_innen des Stadtteils. Die Arbeit von «Critical Friends», die hauptsächlich aus Interviews und teilnehmenden Beobachtungen bestand, wurde von der Projektgruppe dokumentiert und mehrmals als lokale Zeitschrift veröffentlicht. Sie wurde auf diese Weise nicht nur den Auftraggeber_innen und Förder_innen, sondern der Bevölkerung, die zur Teilnahme an den Projekten aufgerufen war, zugänglich gemacht. Die Arbeit an den Ausgaben der Zeitschrift diente der Gruppe gleichzeitig als Werkzeug zur Systematisierung und Auswertung der gesammelten Stimmen und Beobachtungen.
Die auf dieser Basis erarbeiteten Schlussfolgerungen ermöglichten einen Einblick in die lokalen Strukturen und Verhältnisse genauso wie in die weiteren Diskurse und Förderlogiken, in welche die Projekte eingebettet waren. Neben der Betonung von positiven Aspekten der Projekte stellten sie die bisherige Praxis der auftraggebenden Organisation und der Förderung sehr grundsätzlich in Frage. Sie bildeten damit einen spürbaren Kontrast zu den in diesem Feld häufig aus Evaluationen resultierenden Erfolgsgeschichten. Ihre Kritik betraf zum Beispiel die Spannung zwischen dem Anspruch, prozessbasiert und kollaborativ im Stadteil zu arbeiten und den Aufträgen an die Künstler_innen, ein in sich abgeschlossenes Projekt ohne weiterführende Perspektiven in relativ kurzer Zeit durchzuführen; die Arbeitsbedingungen, bei denen die Organisation scheinbar selbstverständlich voraussetzte, dass alle Beteiligten deutlich über die vereinbarte Zeit hinaus tätig wurden; die Kritik, dass die Projekte dazu dienten, Konflikte nicht zu beheben sondern zu beruhigen und kulturelle Betätigung an die Stelle politischer Aktivität treten zu lassen; bis hin zu der Feststellung, dass den meisten Bewohner_innen (bis hin zu den Projektbeteiligten selbst) der Sinn und Nutzen der Projekte unklar blieb. Die Evaluation enthielt auf dieser Basis auch Vorschläge für die Weiterentwicklung des Programms. Nachdem der Evaluationsauftrag abgeschlossen war, blieb die Gruppe der «Critical Friends» bestehen und traf sich weiterhin zur Reflexion der Entwicklungen im Stadtteil.
Hope verweist auf das Problem, dass Projekte wie «Critical Friends» wiederum als Feigenblatt für Auftraggebende dienen können, wenn die in ihnen erarbeiteten Erkenntnisse zu keinen Konsequenzen führen. So stand eine Reaktion der auftraggebenden Organisation auf die Evaluationsergebnisse der Gruppe «Critical Friends» zum Zeitpunkt, da Hope an der Publikation «Participating in the wrong way?» schrieb, noch aus. Die im Eingangszitat von der amerikanischen Dramatikerin Anna Deavere Smith gestellten Fragen könnten in diesem Sinne durch folgende Frage ergänzt werden:
«Who has the right to draw consequences and to take action?»
Literatur und Links
Literatur:
- Smith Anna Deavere Smith: zitiert in Hope, Sophie: Participating in the wrong way?
Four Experiments by Sophie Hope. London, Cultural Democracy Editions, 2011, S. 29
Links:
- Arbeitskreis Theaterpädagogik der Berliner Bühnen, «Wollen Brauchen Können», 2012 [16.10.2012]
- Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater, Hannover; Cagdas Drama Dernegi, Ankara: Inernationales Übereinkommen über das Verhalten und zur Ethik von Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen (ÜVET), 2011 [18.2.2013]; → MFV0804.pdf (deutsch), → MFV0805.pdf (englisch)
- Hope, Sophie: Reclaiming evaluation as a critical practice, Vortrag, University of Melbourne, 2012 [17.10.2012]
- Hull, Hanna, et al.: Toolkits, 2012 [17.10.2012]
- Hull, Hanna, et al.: Criticality and Evaluation in a Culture of Optimism, 2012 [17.10.2012]; → MFV0806.pdf