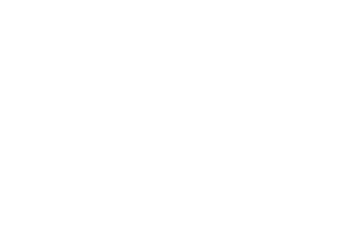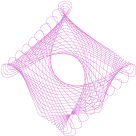Arbeiten in Spannungsverhältnissen 6:
Kulturvermittlung zwischen Legitimationsbedarf und Hegemoniekritik
«An diesem Punkt wird man wohl fragen müssen, ob aus diesen vielfachen Verstrickungen ein Weg herausführt. Kann es, wenn Pädagogik zu den wichtigsten Herrschaftstechnologien gehört, überhaupt so etwas wie eine fortschrittliche oder emanzipatorische Kunstvermittlung geben? […] Die Frage ist entscheidend, denn etwas dazwischen – eine «neutrale Pädagogik» – gibt es nicht.» (Marchart 2005)
Die am Ende des Textes 5.FV geforderte, gleichberechtigte und eigenständige Stellung der Vermittlung (als Praxis und als Diskursfeld) in den Kulturinstitutionen und gegenüber den Künsten ist bisher nur an wenigen Stellen verwirklicht.
Dies führt zu einem weiteren Spannungsverhältnis für eine Kulturvermittlung, die sich als kritische Praxis begreifen möchte. Ihre Vertreter_innen sind darauf angewiesen, Lobbyarbeit für das Arbeitsfeld zu betreiben, sich gegenüber den Institutionen, der Kunst und den kultur- und bildungspolitischen Entscheider_innen und nicht zuletzt gegenüber den eigenen Kolleg_innen zu legitimieren. Naheliegend ist dabei der Rückgriff auf die zur Verfügung stehenden Argumente, wie sie in den Texten für Eilige in «6.Warum (keine) Kulturvermittlung?» aufgeführt wurden. Gleichzeitig sind sie sich der ebenfalls aufgeführten Kritiken, die an diesen Legitimierungen vorgebracht werden, bewusst; zum Teil sind sie auch selbst die Autor_innen dieser Kritiken.1 Bevor Überlegungen dazu angestellt werden, wie dieses Spannungsfeld zu gestalten sei, sollen die wichtigsten Kritiken noch einmal in der Zusammenschau dargestellt werden. Diese bildet gleichzeitig ein Zwischenresümee der in den Vertiefungstexten der vorangegangenen Kapiteln geleisteten Problematisierungen.2
Eine zentrale Kritik bezieht sich auf die Instrumentalisierung der Künste und ihrer Vermittlung als Wirtschafts- und Standortfaktoren. Das Potential der Künste liegt demnach gerade in der Auseinandersetzung mit dem Nutzlosen, nicht Verwertbaren, Provozierenden, Unbequemen, Unwägbaren, Differenten und nicht Übersetzbaren. Initiativen wie der «Kompetenznachweis Kultur» der deutschen Bundesvereinigung für Kulturelle Jugendbildung, bei dem jugendlichen Teilnehmenden in Angeboten der Kulturvermittlung ein Zertifikat ausgestellt wird, weisen aus dieser Perspektive in die falsche Richtung, da sie die Argumente für die Kulturvermittlung stark an deren Nutzen für den Arbeitsmarkt im Sinne gesteigerter «Employability» der Teilnehmenden knüpfen. Dies bedeutet implizit eine Ökonomisierung von Kunst und Bildung. Die Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsbereitschaft wird als grundsätzlich positiv gewertet, wobei ausgeblendet wird, dass gerade auch aus den Künsten heraus andere Visionen für die Gestaltung von Gesellschaft entwickelt werden. Es ist auch festzustellen, dass zumindest bis dato die → Prekarisierung von sogenannten «Kreativen» bestehen bleibt, trotz der Aufwertung ihres Arbeitsfeldes. Im Kontext einer Deregulierung von Märkten und sozialen Systemen eignen sie sich mit den ihnen zugeschriebenen Attributen wie flexibel, risiko- und leistungsbereit und selbstverantwortlich ausgezeichnet als Rollenmodelle.
Die Betonung sogenannter «Transfereffekte» der Kulturvermittlung mit Verweis auf Erkenntnisse der Neurowissenschaften ist ebenfalls vom Wettbewerbsparadigma durchdrungen. Sie fokussiert auf die individuelle Entwicklung und Leistungssteigerung, ohne gesellschaftliche Zusammenhänge zu thematisieren. Zudem tendieren neurowissenschaftliche Begründungen der Kulturvermittlung bislang dazu, konservative Konzepte von kanonisierter Hochkultur als «Kultur» absolut zu setzen. Eltern sollen ihren Embryos Klassik vorspielen, nicht etwa Punkrock.
Vor allem im angelsächsischen Kontext, wo Studien wie «Use or Ornament?» von François Matarasso, die 1997 fünfzig positive Transferwirkungen von Kulturvermittlung auflistete (Matarasso 1997), massive förderpolitische Konsequenzen nach sich zogen, wird die Kritik geäussert, dass solche Studien, ob neurowissenschaftlich oder sozialwissenschaftlich orientiert, nicht wirklich valide seien (Merli 2002). Während neurowissenschaftlich informierte Argumente für Kulturvermittlung die individuelle kognitive Leistung in den Mittelpunkt stellen, betonen sozialwissenschaftliche Untersuchungen wie die von Matarasso die positiven Transferwirkungen von Kulturvermittlung im sozialen Kontext und auf das Sozialverhalten. An dieser Legitimation ist kritikwürdig, dass «kulturelle Teilhabe» dabei an die Stelle realer politischer Mitbestimmung tritt. Als Beispiel hierfür sei eine konservative Regierung eines deutschen Bundeslandes erwähnt, die nach ihrem Antritt den regionalen Anti-Rasissmus-Initiativen die Gelder kürzte und gleichzeitig die freien Kunstschulen in der Region dazu verpflichtete, Projekte in Hauptschulen «mit hohem MigrantInnenanteil» durchzuführen (Mörsch 2007). Nicht nur ereignete sich an dieser Stelle eine Verschiebung der Problembekämpfung von den Täter_innen weg zu den Betroffenen, auch handelte es sich implizit um die
→ Kulturalisierung
des politischen und gesamtgesellschaftlichen Problems. Verschärft wird diese Problematik dadurch, dass der Kulturbegriff doppelt belastet ist: «Das Aufkommen des Kulturbegriffs ist mit einem Identifizierungsproblem behaftet, weil sich eine Kultur nur im Unterschied zu anderen Kulturen bestimmt. Im Namen der Kultur wird regelmässig die Ablösung traditioneller Werte, die die Moderne charakterisiert, zu Gunsten einer emphatischen Selbststiftungsphantasie umgedeutet, die per se die kulturellen Unterschiede asymmetrisch nach dominanten und inferioren Merkmalen konzeptualisiert. […] Von daher gibt sich jede Kultur als kolonial zu erkennen» (Rölli 2006, S.30–41). Bei dem Postulat, kulturelle Bildung sei per se gut für «die Menschen» muss also bedacht werden, dass mit ihr häufig die zumindest implizite Vermittlung westlicher, auch nationalidentitärer Wertvorstellungen erfolgt. Umgekehrt birgt das Postulat der Förderung «kultureller Vielfalt» die Gefahr von → ethnischer Essentialisierung, da Personen auf die – von aussen zugeschriebenen – kulturellen Praktiken ihrer Herkunftsländer verwiesen werden. Den derart adressierten Akteur_innen wird kaum ein anderer Platz innerhalb des kulturellen Feldes gewährt (→ Steyerl 2007, S.21–23). Dieser kritische Einwurf erhält eine besondere Brisanz, da gegenwärtig eine Verschiebung vom «biologischen» zum «kulturellen Rassismus» zu beobachten ist. Rassistisch motivierte Übergriffe, staatliche Kontrolle, Gesetzesverschärfungen und Medienberichterstattung richten sich zunehmend an einer Matrix von als «kulturell» markierten Oppositionen wie «islamisch kontra abendländisch» aus (Taguieff 1998).
Eine Vorgabe wie die oben beschriebene an die Jugendkunstschulen mag in guter Absicht erfolgen. Selten wird jedoch bei solchen Unterfangen der gesellschaftliche Kontext, der zur Ungleichbehandlung erst führt, in die Arbeit an Veränderungen einbezogen. Es bleibt bei diesen Arrangements in der Regel die Aufgabe der individuell Betroffenen, ihre Situation zu überwinden und sich zu interessieren. Genauso wenig werden die → paternalistischen Zuschreibungen reflektiert, die über die Adressierungen minorisierter Gruppen erfolgen. Problematisch am Inklusionsgedanken ist ausserdem, dass er Kultur und ihre Institutionen als unhinterfragbare Grösse voraussetzt, die für alle Menschen gut und nützlich sei, ohne dass sie sich selbst verändern müssten.
In der Zusammenschau wird noch einmal deutlich, dass die angeführten Kritiken eines gemeinsam haben: Sie analysieren scheinbar selbstverständliche gesellschaftliche Übereinkünfte und Verhältnisse und scheinbar neutrale Kontexte wie Kultur- oder Bildungseinrichtungen als Grundlage für die Reproduktion von Ungleichheit und für die Hervorbringung von gesellschaftlichen Normen. Es handelt sich entsprechend, wie am Ende des Textes 1.FV erläutert, um hegemoniekritische Einwände.
Leitlinien für daraus resultierende Handlungsalternativen zur Verschiebung und Umarbeitung der hegemonialen Ordnung im Zeichen einer Kunstvermittlung als kritischer, verändernder Praxis wurden bereits von mehreren Autor_innen umrissen, die alle sowohl in der Theoriebildung als auch in der Vermittlungsarbeit tätig sind (Sternfeld 2005; Sturm 2002; Mörsch et al. 2009). Sie seien hier genauso wie die oben aufgeführten Kritiken zusammengefasst.
Kulturvermittlung als (hegemonie-)kritische Praxis betont das Potential der Differenzerfahrung beim Bilden mit Kunst und setzt dem Effizienzdenken die Aufwertung von Scheitern, von Suchbewegungen, von offenen Prozessen und offensiver Nutzlosigkeit als Störmoment entgegen. Anstatt Individuen den Willen zur permanenten Selbstoptimierung als beste Überlebensoption anzubieten, stellt sie Räume zur Verfügung, in denen – neben Spass, Genuss, Lust am Machen, Schulung der Wahrnehmung sowie der Vermittlung von Fachwissen – auch Probleme identifiziert und bearbeitet werden können. In denen Dissens konstruktiv wahrgenommen wird.
In denen so scheinbar selbstverständlich positive Attribute wie die Liebe zur Kunst oder der Wille zur Arbeit hinterfragt werden und eine Diskussion darüber in Gang kommen kann, was eigentlich für wen das gute Leben sei und wie ein gutes Leben für alle zu bewerkstelligen sei. In denen es daher weniger um lebenslängliches als um lebensverlängerndes Lernen geht.
Sie eröffnet Handlungsräume, in denen keine Person aufgrund ihres Alters, ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer körperlichen Dispositionen, ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert wird, in denen kein vermeintliches Wissen über Andere produziert wird oder als Grundlage dient, sondern in denen stattdessen im Sinne einer kommunikativen pädagogischen Reflexivität parteilich gehandelt wird.
In denen es daher auch notwendig ist, die eigene Privilegiertheit als Kulturvermittler_in zu reflektieren, sie zu durchkreuzen und sie strategisch für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Denn trotz möglichem materiellem Mangel und möglicher schwacher Position im institutionellen Gefüge gibt es unter der Mehrheit der Kulturvermittler_innen viele Privilegien, wie die richtige Hautfarbe, den Zugang zum richtigen Wissen und zur richtigen Kultur (Castro Varela, Dhawan 2009).
Solche Räume der Kulturvermittlung weisen als konstitutive Merkmale eine Reflexivität gegenüber dem Kulturbegriff und aktiven Widerstand gegen Kulturalisierung von Konflikten und politischen Problemen auf, genauso wie eine Reflexivität gegenüber den mit «Kunst» verbundenen Wertvorstellungen und Mythen. Die Vermittlungsarbeit dient entsprechend auch dem Austausch darüber, wie die Künste und ihre → Teilsysteme funktionieren.
Statt «Begabungsförderung» und «Selbstentfaltung» wird in ihnen die transparente Vermittlung von Werkzeugen zum Lernen versucht. Dieser Versuch basiert auf einem Nachdenken über die eigenen Ausgangspunkte und Bedingungen sowie auf dem Potential der Künste (auch kollektiv und über Wissens- und Sprachgrenzen hinweg) zu entwerfen, zu intervenieren, umzudeuten und zu verändern. Und, um den Kreis zu schliessen, diese Arbeit fusst auf den besonderen Möglichkeiten der Künste, all dem jeweils Formen zu geben, die vieldeutig bleiben und sich im günstigen Fall einer Instrumentalisierung entziehen.
Wie oben angedeutet, ist der Versuch, Kulturvermittlung als kritische Praxis ins Werk zu setzen, ein mehrfach destabilisierendes Unterfangen. Besonders in einem Feld, das zur Zeit noch stark mit dem Kampf gegen Abwertung, gegen seine eigene Prekarisiertheit und mit Selbstlegitimierung beschäftigt ist, produziert dieser Zugang zusätzliche Stolpersteine. Er bedeutet, neben dem Modus der permanenten Selbstbefragung, auch bei den Kolleg_innen im eigenen Arbeitsfeld nicht ausschliesslich auf breite Akzeptanz zu stossen. Auch gibt es kaum eine dokumentierte Geschichte, auf die sich eine kritische Kulturvermittlung selbstverständlich beziehen könnte. Bis vor nicht langer Zeit war Kulturvermittlung ein reines Praxisfeld, daher sind die Geschichtsschreibung und die Theoriebildung noch jung.
Dennoch wächst zur Zeit die Zahl von Kulturvermittler_innen, die an der Weiterentwicklung einer kritischen Praxis in den vielen möglichen Facetten, die aus den oben aufgeführten Vorschlägen aufscheinen, interessiert sind. Sie entwickeln Umgangsweisen mit dem oben erwähnten Spannungsverhältnis zwischen einer hegemoniekritischen Haltung und einem Bedarf nach Legitimationen. Diese Umgangsweisen lassen sich als zwei miteinander verbundene Stossrichtungen beschreiben: Netzwerkbildung und damit die Stärkung und Weiterentwicklung der jeweils eigenen Position durch einen kollektiven Zusammenhang sowie der jeder Hegemoniekritik innewohnende Kampf darum, selbst hegemonial zu werden, und die damit einhergehende Bildung von Allianzen. Die Vernetzung von Kulturvermittler_innen, die an einer kritischen Praxis interessiert sind, ereignet sich gegenwärtig an vielen Orten. Zentral sind dafür Symposien und vor allem Symposionsreihen, weil diese die Möglichkeit der Wiederbegegnung und der Fortsetzung von Diskussionen eröffnen. So zum Beispiel die Reihe «Educational Turn» des Netzwerks → schnittpunkt. ausstellungstheorie und praxis3, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren sehr unterschiedliche Akteur_innen mit einem Interesse am → Educational Turn zusammen und miteinander in Diskussion brachte (schnittpunkt 2012). Eine ähnliche Vorgehensweise entwickelte die von Javier Rodrigo und Aida Sanchez de Serdio Martins in Spanien konzipierte Symposionsreihe «Prácticas dialógicas» (Rodrigo 2007), die ebenfalls einmal jährlich in verschiedenen Museen Spaniens stattfand und einen wichtigen Beitrag zur Bildung eines informellen Netzwerks von kritisch orientierten Kunstvermittler_innen leistete. Gegenwärtig entsteht unter dem Namen «Another Roadmap» ein internationales Netzwerk, dessen Motor zur Vernetzung die kritische Lesung der → UNESCO Roadmap for Arts Education bildet. Bei der UNESCO Roadmap handelt es sich um ein Lobbypapier, das sich für die Etablierung von Kulturvermittlung (vor allem der schulischen, aber auch der ausserschulischen) in allen Ländern der Welt starkmacht. An diesem Papier zeigt sich deutlich das Dilemma einer hegemoniekritischen Kulturvermittlung. Einerseits muss auch aus ihrer Perspektive ein solcher Vorstoss begrüsst werden. Andererseits bieten die in dem Papier vorgebrachten Legitimationen Anlass für alle in diesem Kapitel aufgeführten Kritiken. So zum Beispiel, dass die darin verwendeten Konzepte von «Kultur» wie von «Bildung» westlich geprägt sind und durch das Papier universalisiert werden, ohne ihre koloniale Geschichte zu reflektieren; dass Bildung in den Künsten vor allem dazu dienen soll, flexible Arbeitskräfte zu produzieren und soziale Spannungen zu mildern; dass ein Konzept von indigenem Kunstschaffen dominiert, das dieses vor allem als «Traditionen» konservieren will und nicht als Teil zeitgenössischer Kulturproduktion begreift; dass ein konservatives Konzept von Familie (und eine damit verbundene Erzählung vom Verlust moralischer Werte) zum Tragen kommt, welches der Pluralität bestehender, gern gelebter Sozialformen nicht entspricht. Wie jedes Ergebnis eines internationalen Aushandlungsprozesses spiegelt auch die UNESCO Roadmap for Arts Education wenig überraschend auf vielfache Weise die hegemoniale Ordnung und repräsentiert daher nicht diejenigen Positionen, die ihre Arbeit gerade aus Gegenentwürfen zu dieser Ordnung heraus begründen. Gleichzeitig hat das Papier aber auch bewirkt, dass die Akteur_innen der Kulturvermittlung begonnen haben, sich als global agierendes, professionelles Feld wahrzunehmen. Das internationale Netzwerk mit dem provisorischen Titel → Another Roadmap for Arts Education entwickelt in Auseinandersetzung mit dem UNESCO-Papier und ähnlichen Verlautbarungen Forschungen und Projekte. Zum einen geht es darum, alternative Begründungen für die Kulturvermittlung anhand von Beispielen zu erarbeiten. Zum zweiten soll mit einer Geschichtsschreibung der Kulturvermittlung begonnen werden, welche ihre globale Dimension, den Transfer von Konzepten von Kunst wie von Bildung im Kolonialismus genauso wie deren Umarbeitungen in postkolonialen Kontexten in den Blick nimmt. Dies aber nicht, um sich jenseits von Widersprüchen zu verorten, sondern um von innen heraus einen aktiven, kritisch perspektivierten Beitrag zu den gegenwärtigen Debatten über die Gründe für Kulturvermittlung zu leisten.
Dass sich Hegemoniekritik nicht ausserhalb der Verhältnisse verortet, zeigt auf einer anderen Ebene eine 2012 entstandene Untersuchung über Geschäftsmodelle selbstständig arbeitender Vermittler_innen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Entgegen der eigenen Ausgangshypothese kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass die kritisch und künstlerisch ausgerichteten Vermittler_innen wirtschaftlich erfolgreicher agieren als diejenigen, welche sich → affirmativ zum Kunstfeld positionieren und deren Angebot eher im Bereich der Dienstleistung anzusiedeln ist (→ Pütz 2012). Dies ist unter anderem auf ihr durch den kritischen Zugang erworbenes, umfassendes Systemwissen zurückzuführen, das sie bei der Akquise von Projekten strategisch einsetzen können. Dass es sich bei den Auftraggeber_innen vor allem um öffentliche Organisationen der Kultur und Bildung handelt, könnte zusätzlich als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Handlungsvorschläge einer kritischen Kulturvermittlung zumindest an manchen Orten im Mainstream angekommen sind.
1 Dies gilt für die Autorin dieses Textes oder für Protagonist_innen wie z.B. Nora Landkammer, Nanna Lüth, Javier Rodrigo, Nora Sternfeld, Rahel Puffert, Stephan Fürstenberg, Janna Graham und viele andere, die aktiv an der Etablierung des Arbeitsfeldes Kulturvermittlung beteiligt sind und gleichzeitig mit analytischen und programmatischen Texten zu dessen kritischen Diskursen beitragen.
2 Da es sich im Folgenden um eine Zusammenfassung bereits ausgeführter Positionen handelt, werden die dazugehörigen Literaturangaben und Verweise auf andere Kapitel nicht noch einmal angeführt. Dies dient der Lesefreundlichkeit. Nur wenn neue Aspekte auftauchen, erscheint dazu auch die entsprechende Literatur.
3 «schnittpunkt. ausstellungstheorie und praxis ist ein offenes, transnationales Netzwerk für Akteur_innen sowie Interessierte des Ausstellungs- und Museumsfeldes. Als Plattform ausserhalb des institutionalisierten Betriebes bietet schnittpunkt seinen Mitgliedern die Möglichkeit für interdisziplinären Austausch, Information und Diskussion. Die Sichtbarmachung institutioneller Deutungs- und Handlungsmuster als kulturell und gesellschaftspolitisch bedingt, ist dabei ebenso Ziel wie die Herstellung einer kritisch-reflexiven Ausstellungs- und Museumsöffentlichkeit» (schnittpunkt 2012).
Literatur und Links
Der Text basiert in Teilen auf folgendem bereits erschienenen Beitrag:- Mörsch, Carmen: «Glatt und Widerborstig: Begründungsstrategien für die Künste in der Bildung», in: Gaus-Hegener, Elisabeth; Schuh, Claudia (Hg.): Netzwerke weben – Strukturen bauen. Künste für Kinder und Jugendliche, Oberhausen: Athena, 2009, S.45–60
- Castro Varela, Maria do Mar; Dhawan, Nikita: «Breaking the Rules. Bildung und Postkolonialismus», in: Mörsch, Carmen, und das Forschungsteam der documenta 12 Vermittlung: Kunstvermittlung 2. Zwischen Kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts, Zürich: diaphanes, 2009, S.350
- Marchart, Oliver: «Die Institution spricht. Kunstvermittlung als Herrschafts- und als Emanzipationstechnologie», in: schnittpunkt (Beatrice Jaschke, Nora Sternfeld) (Hg.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen, Wien: Turia und Kant, 2005, S.34–58
- Matarasso, François: Use or Ornament. The Social Impact of Participation in the Arts, London: Comedia 1997/2000 – Merli, Paola: «Evaluating the social impact of participation in arts activities. A critical review of François Matarasso’s ‹Use or Ornament?›», in: International Journal of Cultural Policy, Nr.8 (1), 2002, S.107–118
- Mirza, Munira (Hg.): Culture Vultures. Is UK arts policy damaging the arts? London, 2006 [21.2.2013]
- Mörsch, Carmen: «Im Paradox des grossen K. Zur Wirkungsgeschichte des Signifikanten Kunst in der Kunstschule», in: Mörsch, Carmen; Fett, Sabine (Hg.): Schnittstelle Kunst – Vermittlung. Zeitgenössische Arbeit in Kunstschulen, Bielefeld: Transcript, 2007, S.360–377
- Mörsch, Carmen, und das Vermittlungsteam der documenta 12: Kunstvermittlung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts, Zürich: diaphanes, 2009 (Mörsch 2009a)
- Pütz, Joline: Mapping der Selbstständigkeit in der Kunstvermittlung. Eine Untersuchung anhand von vier Beispielen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland, Masterarbeit im Master of Arts in Art Education, Vertiefung Ausstellen und Vermitteln, Zürcher Hochschule der Künste 2012; → MFV0603.pdf
- Raunig, Gerald; Wuggenig, Ulf: Die Kritik der Kreativität, Wien: Turia und Kant, 2007
- Rodrigo, Javier (Hg.): Prácticas dialógicas. Intersecciones entre Pedagogía crítica y Museología crítica, Palma de Mallorca: Museu d’Árt Contemporani a Mallorca Es Baluard, 2007
- Rölli, Marc: «Gilles Deleuze: Kultur und Gegenkultur», in: Moebius, Stephan; Quadflieg, Dirk (Hg.): Kultur. Theorien der Gegenwart, Wiesbaden: VS Verlag, 2006, S.30–41
- schnittpunkt (Beatrice Jaschke, Nora Sternfeld) (Hg.): Educational Turn. Handlungsräume der Kunst- und Kulturvermittlung, Wien: Turia und Kant, 2012
- Sternfeld, Nora: «Der Taxispielertrick. Vermittlung zwischen Selbstregulierung und Selbstermächtigung», in: schnittpunkt (Beatrice Jaschke, Nora Sternfeld) (Hg.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen, Wien: Turia und Kant, 2005, S.15–33
- Steyerl, Hito: «Kultur: Ein Begriff ohne Grenzen. Alltag und Verbrechen», in: Köchk, Sylvia, et al.: fields of TRANSFER. MigrantInnen in der Kulturarbeit, Wien: IG Kultur, 2007, S.21–23 [21.2.2013]; → MFV0602.pdf
- Sturm, Eva: «Kunstvermittlung als Widerstand», in: Schöppinger Forum der Kunstvermittlung. Transfer. Beiträge zur Kunstvermittlung Nr.2, 2002, S.92–110
- Taguieff, Pierre-André: «Die Metamorphosen des Rassismus und die Krise des Antirassismus», in: Bielefeld, Ulrich (Hg.): Das Eigene und das Fremde. Neuer Rassismus in der Alten Welt?, Hamburg: Hamburger Edition, 1998, S.221–268
- UNESCO, World Conference on Arts Education, Lisbon 2006/Seoul 2010, Roadmap [30.4.2012]; → MFE060501.pdf
- Another Roadmap for Arts Education[15.3.2013]
- schnittpunkt. ausstellungstheorie und praxis [14.10.2012]