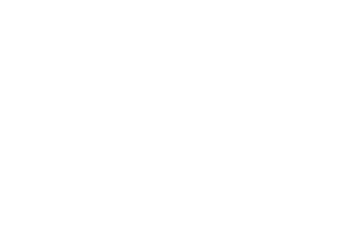Arbeiten in Spannungsverhältnissen 1:
Geschichte der Kulturvermittlung zwischen Emanzipation und Disziplinierung
« … kaum ein Verbum, das nicht sprachgebräuchlich oder scherzhaft mit ver- zusammengesetzt werden könnte, und die Grundanschauung ist dabei immer eine Bewegung vom Sprechenden hinweg, eben ein Verlust.» (Mauthner 1913)
«Je me suis aperçu que l’initiation consistait à inquiéter les gens et ne rien leur apprendre.» (Caillet 1995)
Kulturvermittlung – und speziell die Vermittlung der Künste – ist nicht (nur) als Mitteilung, Erklärung, Beschreibung oder ein durch Fachleute bewerkstelligter, möglichst reibungsloser Wissenstransport von vermeintlich Wissenden hin zu vermeintlich Unwissenden zu denken. Der in ihr wirkende Streit darüber, wer jeweils das Recht und die Möglichkeit hat, die Künste zu besitzen, zu sehen, zu zeigen und über sie zu sprechen, ist fast so alt wie die Künste selbst. Bereits in den Briefen des Plinius, die zu Beginn des ersten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung entstanden, finden sich Hinweise auf öffentlich geführte Kontroversen darüber, ob Kunstsammlungen als Privateigentum verschlossen sein dürfen oder öffentlich zugänglich sein sollten (Wittlin 1949, S.109). In der Moderne entstanden im Zuge der Umwälzungen durch die Französische Revolution und die Industrialisierung Bedarfe, die sich zunächst in die Gründung öffentlicher Museen und wenig später in die Praxis der Museumsvermittlung einschrieben: die Rechtfertigung des staatlichen Besitzes von im Rahmen von Eroberungskriegen und Kolonialisierung geraubten Kulturgütern; die Verbreitung nationaler Gründungsgeschichten zur Bildung von Nationalbewusstsein in der Bevölkerung; die Disziplinierung einer wachsenden Arbeiterschicht im Sinne bürgerlicher Lebenskonzepte; die Notwendigkeit ästhetischer Bildung (im Sinne von gestalterischen Fertigkeiten und von Geschmacksbildung) zur Sicherung von Kapazitäten im Rahmen des wirtschaftlichen, globalen/kolonialen Wettbewerbs; aber auch die Idee der Demokratisierung von Bildung und – weiterhin – der Künste als Teil des öffentlichen Lebens, auf den sämtliche Mitglieder einer Gesellschaft einen Anspruch haben (Sturm 2002b, S.199 ff.).
In England wurden unter diesen Vorzeichen im 19. Jahrhundert Museen als Bildungsorte für Schulklassen, nach der Weltausstellung 1851 auch für die Erwachsenenbildung institutionalisiert. Es entstanden «Philanthropic Galleries», in denen Sozialreformer_innen, Geistliche und auch Künstler_innen Gemälde und Skulpturen als Werkzeuge einsetzten, um Besitzlosen und Fabrikarbeiter_innen bürgerliche Tugenden nahezubringen und die Künste als Bestandteil einer gelungenen Lebensgestaltung über Klasse und Herkunft hinweg zu behaupten (→ Mörsch 2004a). Manche davon, zum Beispiel die South London Gallery, entstanden aus → Working Men Colleges, also aus der Arbeiterbewegung heraus. Die aus der Reformpädagogik stammende deutsche Kunsterziehungsbewegung propagierte Anfang des 20. Jahrhunderts die pädagogische Notwendigkeit des freien Ausdrucks des Individuums. Hiervon beeinflusst wurden im Rahmen der Volksbildung international Zugänge zur Vermittlung von Musik, Theater und bildender Kunst (als Werkrezeption und als sogenannte Laienbeschäftigung) entwickelt. Doch «freier Ausdruck» bedeutete schon damals nicht Zweckfreiheit. Ähnlich wie bei Friedrich Schiller, der in seiner 1801 erschienenen Publikation «Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reyhe von Briefen» (Berghahn 2000) ästhetische Erziehung als ein Werkzeug entwarf, um die Persönlichkeitsentfaltung des Individuums unter Vermeidung eines auch mit gewaltsamen Mitteln geführten Kampfes gegen bestehende Herrschaftsverhältnisse zu ermöglichen, artikulierten sich auch in den Schriften der Kunsterzieherbewegung Ziele: «Denn die Erneuerung der künstlerischen Bildung unseres Volkes ist in sittlicher, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine der Lebensfragen unseres Volkes», schrieb Alfred Lichtwark, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, der als Begründer der musealen Kunstvermittlung in Deutschland gilt, in seinem Aufsatz «Der Deutsche der Zukunft». Dieser erschien in der Publikation zum ersten Kunsterziehertag in Dresden im Jahr 1901. Kulturvermittlung erscheint hier als Mittel, ein Land als Wirtschafts- und Kulturnation zu behaupten. Eine historische Studie von 2005 zeigt damit korrespondierend exemplarisch auf, dass ästhetische Bildung im Kolonialismus eingesetzt wurde, um europäische Wertvorstellungen und Regierungsweisen durchzusetzen (Irbouh 2005). Gleichzeitig wurden auch Konzepte für eine Kulturvermittlung im Zeichen der Emanzipation marxistischer Prägung weiterentwickelt. So schrieb Walter Benjamin ein massgeblich durch das proletarische Kindertheater von Asja Lacis beeinflusstes Programm zur Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Benjamin 1977, S.764 ff.).
Von Beginn an ist die Bekämpfung sozialer Ausschlüsse im kulturellen → Feld ein Anspruch und ein nie eingelöstes Ziel von Kulturvermittlung. Lichtwark, der selbst aus armen Verhältnissen kam, verfolgte die Absicht, Bildung in den Künsten für alle Bevölkerungsschichten zu ermöglichen, führte aber seine «Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken» (Lichtwark 1897) mit Schülerinnen der höheren Töchterschule durch. Die seit den 1960er Jahren in Deutschland gegründeten «Freien Kunstschulen» genauso wie die «Kreativwerkstätten» in Zürcher Gemeinschaftszentren sprechen in der Regel bis heute eine eher ausgewählte Klientel an, vor allem im Vergleich mit soziokulturellen Angeboten, bei denen Kunst nicht im Mittelpunkt steht. Die in Frankreich in den 1950er Jahren einsetzenden Bestrebungen, das zeitgenössische Theater zu dezentralisieren und zu popularisieren, haben zwar die Theaterlandschaft des Landes grundlegend verändert, die Zusammensetzung des Publikums jedoch nur sehr bedingt (Duvignaud, Lagoutte 1986, S.64; Bérardi, Effinger 2005, S.75 ff.). Vermittlungsangebote aus dem Bereich der klassischen Musik erreichen bislang ebenfalls fast ausschliesslich eine bereits interessierte Öffentlichkeit (→ Aicher 2006). Kunst- und Musikhochschulen wiederum sind bis heute europaweit die exklusivsten tertiären Bildungsorte: Noch nicht einmal für den Zugang zur Universität braucht es eine so umfangreiche Vorinvestition – sei es in Form von symbolischem oder → ökonomischem Kapital (→ Seefranz, Saner 2012). Dabei handelt es sich um Institutionen, die für sich in Anspruch nehmen, ihre Studierenden ausschliesslich nach «Begabung» auszuwählen – ein Konzept, das im Allgemeinen unabhängig von sozialem oder nationalem Hintergrund gedacht wird.
Die Begriffe «Kultur» und «Kunst» sind demnach nicht neutral, sondern mit Normen aufgeladen und entsprechend umkämpft. Jemand gilt als «kultiviert», wenn er oder sie im Sinne des Soziologen Pierre Bourdieu (Bourdieu 1982) über eine bestimmte Zusammensetzung von Geschmack und Kennerschaft verfügt, die sich zum Beispiel über die Kenntnis der Künste und des Designs, den Konsum von Genussmitteln, den Umgang mit den eigenen und anderen Körpern oder über Kleidungs- und Kommunikationsstile artikuliert. Was jeweils zum Ensemble von Kultiviertheit gehört, unterliegt dem Wandel, wobei eines konstant bleibt: «Kultur» steht hier für die Behauptung und Unterscheidung anerkannter Lebensstile. Daneben wird der Begriff, verbunden mit einem kolonial geprägten Weltverständnis, auch ethnisch abgrenzend, im Sinne von «eigener» und «fremder» oder «anderer Kultur», verwendet.1 Bourdieu hat seine Studie «Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft» bereits 1979 veröffentlicht. Doch die Forschungen, die sich heute noch auf ihn beziehen, sind zahlreich. Denn beide Abgrenzungsfunktionen – die von einer gesellschaftlichen Schicht zur anderen und die, welche das vermeintlich «Eigene» vom vermeintlich «Fremden» zu unterscheiden sucht – sind, so alt und bekannt sie auch sein mögen, weiterhin wirksam. Vor diesem Hintergrund sind Versuche zu lesen, den Kulturbegriff zwar weiterhin zu verwenden, ihn jedoch gerade der beschriebenen Distinktionsfunktionen zu entledigen. So plädieren seit den 1920er Jahren die französische Arbeiterbildungsbewegung, seit den 1950er Jahren die in England entstandenen Cultural Studies oder auch die brasilianische Befreiungspädagogik (Freire 1974) für einen erweiterten Kulturbegriff, der Alltagspraktiken und «populäre» Phänomene einschliesst. Kulturelle Praxis sowie ihre Erforschung und Vermittlung sollen in diesem Verständnis den Kampf gegen Ungleichheit, zum Beispiel entlang von ökonomischen Verhältnissen oder der Kategorien Geschlecht, Ethnizität oder nationale Herkunft, unterstützen, anstatt diese zu bestätigen und zu reproduzieren. In dieser Tradition stehen auch Teile der Kulturpädagogik und der → soziokulturellen Animation im deutsch- und französischsprachigen Raum seit den 1970er Jahren sowie die Praxis von Künstler_innen in Schulen und in Einrichtungen der non-formalen Bildung (→ Mörsch 2005). Zur gleichen Zeit wird vor allem im angelsächsischen und angloamerikanischen Raum von Bürgerrechtsbewegungen in Allianz mit Künstler_innen die Forderung nach Sichtbarkeit und Mitgestaltung von Minderheiten im künstlerischen Feld erhoben – eine Forderung, bei deren Durchsetzung Akteur_innen der Kulturvermittlung seither aktiv beteiligt sind (→ Allen 2008).
Angesichts der hier in alle Kürze geschilderten, historisch gewachsenen Spannungsverhältnisse erscheint es nicht weiter erstaunlich, dass Kulturvermittlung eine heterogene Praxis ist. Je nach Zielvorstellung, Kunst- und Bildungsverständnis kann sie sich ganz unterschiedlich positionieren und gestalten. Steht die Idee der Vergrösserung des Publikums von etablierten Kulturinstitutionen im Vordergrund, so siedelt sie nah am Bereich des Marketings. Wird sie zuerst als Bildungsgeschehen in einem demokratisch-zivilgesellschaftlichen und/oder künstlerischen Sinne verstanden, gewinnt die pädagogische Dimension im Sinne eines Anstossens und Moderierens von Debatten oder eines Anleitens und Begleitens künstlerisch-gestalterischer Prozesse an Relevanz. Soll sie vor allem der wirtschaftlichen Entwicklung, zum Beispiel der Förderung sogenannter Kreativindustrien, dienen, ist sie womöglich von unternehmerischen Logiken geleitet. Zielt sie vor allem auf die Bekämpfung von Strukturen, die Ungleichheit erzeugen, weist sie Schnittstellen zur sozialen Arbeit oder zum Aktivismus auf. Bei all dem kann sie sich auch als künstlerisch informierte Praxis verstehen – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Künstler_innen seit langer Zeit massgeblich an der → Etablierung der Kulturvermittlung als Praxisfeld beteiligt sind und dieses mit geprägt haben (Mörsch 2004a). Doch welcher Schwerpunkt auch gesetzt wird: Institutionalisierte Kulturvermittlung befindet sich per se in einer ambivalenten Lage. Sie dient der Stabilisierung und Legitimierung der Kulturinstitutionen, da sie für (das) Publikum sorgt und die Anliegen der Institutionen nach aussen vertritt. Sie bildet aber auch ein permanentes Störmoment, da allein schon die Tatsache ihrer Existenz an den niemals ganz eingelösten Anspruch erinnert, die Künste als Gemeingut zu betrachten. Es mag mit dieser Verweisfunktion, mit dieser Produktion von Differenz innerhalb des Systems zusammenhängen, dass ihr Status häufig → Prekär und zumeist eher im unteren Bereich der institutionellen Hierarchie angesiedelt ist. Entsprechend → feminisiert ist bis dato die Praxis. Kulturvermittlung sieht sich zudem seitens des künstlerischen Feldes immer wieder dem Verdacht ausgesetzt, Verrat an der Kunst zu begehen – zum Beispiel, indem das Sprechen über die Künste vom Sprechen im Fachdiskurs abweicht. Oder weil durch die Vermittlung Leute im künstlerischen Feld auftauchen, die durch ihre Präsenz dessen Routinen unterbrechen und es sich unvermittelt seiner selbst gewahr werden lassen.
Ab Mitte der 1990er Jahre wurden in Antwort auf diese Spannungsverhältnisse Konzepte der Kulturvermittlung entwickelt, die gerade die Differenzproduktion und die Unerfüllbarkeit der Aufgabe als produktiven Ausgangspunkt für die Praxis verstehen. 1994 entstand auf Antrag des französischen Kultusministeriums und fussend auf einer Bedarfserhebung der Studiengang «Médiation culturelle de l’art» an der Université Aix-Marseille in Frankreich. Leiter war bis 2006 → Jean-Charles Bérardi, ein Kunstsoziologe, der sich in seinem Zugang unter anderem auf Pierre Bourdieu und auf dessen Arbeit aufbauende Studien bezog. Aus seiner Perspektive ist die Médiation culturelle de l’art ein politisches Arbeitsfeld. In diesem geht es darum, Kultureinrichtungen als öffentliche Räume einzufordern. Darin soll die Spannung zwischen Kunst und Öffentlichkeit nicht entschärft, sondern vielmehr zum Ausgangspunkt und zum Inhalt von Debatten werden. Zu fragen wäre in der Médiation Culturelle des Arts nach der gesellschaftlichen Relevanz der Künste und umgekehrt nach der Relevanz der Gesellschaft für das künstlerische Feld (Bérardi, Effinger 2005, S.80). Für dieses Konzept der Médiation culturelle de l’art sind die Sprachwissenschaften leitend, darunter die Ansätze des Psychoanalytikers Jaques Lacan (Effinger 2001, S.15). Danach produziert das Sprechen über die Künste grundsätzlich einen Mangel, weil die Sprache nie mit dem, auf das sie verweist, identisch ist. Es bleibt immer ein unübersetzbarer Rest, der nicht gesagt werden kann. Dieser Mangel ist mit Lacan betrachtet jedoch produktiv. Er ist die Grundlage für die Konstitution des Ichs, für die Wahrnehmung von Alterität und damit für die fortgesetzte Herstellung von Symbolen. Jean Caune, einer der massgeblichen Theoretiker der französischen Médiation Culturelle, spricht in diesem Zusammenhang von der «brêche» (dt. Zwischenraum/Öffnung/Leere) (Caune 1999, S.106 ff.), durch die das Andere aufscheint, das niemals vollständig verstanden werden kann. Das Verfehlen des Anspruchs, den Bruch zwischen den Künsten und der Gesellschaft durch Erklären und Zugänglichmachen zu reparieren, betrachtet er aus dieser Perspektive als Grundlage für ein Verständnis der Médiation Culturelle. Sie wird nicht als Informationsübertragung, sondern als performativer Akt, als Prozess des Herstellens von Beziehungen zwischen den beteiligten Subjekten (z.B. Vermittler_innen, Publikum), den Ausdrucksträgern (z.B. Werken) und gesellschaftlichen Rahmungen (z.B. Kulturinstitutionen) entworfen. Hierin sieht Elisabeth Caillet, eine weitere zentrale Vertreterin der französischen Médiation Culturelle, eine Parallele zu der komplexen Beziehung von Künstler_in, Werk und Welt (Caillet 1995, S.183). Einen mit diesem Entwurf korrespondierenden Ansatz entwickelte unabhängig davon für den deutschsprachigen Raum die Kunstvermittlerin und Theoretikerin Eva Sturm. In ihrem 1996 erschienenen, für die deutschsprachige Kunstvermittlung höchst einflussreichen Buch «Im Engpass der Worte. Sprechen über moderne und zeitgenössische Kunst» (Sturm 1996) analysiert sie die Sprechakte in der Kunstvermittlung im Museum ebenfalls mit Lacan. Spricht Caune von der «brêche», spricht Sturm vom «Lücken reden» (Sturm 1996, S.100). Kunstvermittlung wird bei ihr zu einem performativen Akt der Übersetzung, bei dem immer etwas verloren geht und etwas Neues hinzukommt, also etwas Drittes entsteht, das mit dem zu übersetzenden Inhalt niemals identisch ist. Vermitteln heisst dementsprechend auch bei ihr nicht Erklären und Schlichten. Ver-mittlung realisiert die im Eingangszitat angedeuteten Potentiale der Vorsilbe Ver-, im Sinne der Verstrickung, des Kontrollverlustes und des Verfehlens zugunsten der Herstellung von nicht (immer) steuerbaren Beziehungsgeflechten und Handlungsräumen.
Über das oben beschriebene systemische Störmoment hinaus, das, wie hier gezeigt wurde, mit institutioneller Kulturvermittlung als Symptom immer schon verbunden ist, entstanden im letzten Jahrzehnt und mit Rückbesinnung auf die oben beschriebenen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre Konzepte für eine Kunstvermittlung als hegemoniekritische Praxis, als bewusst betriebene Unterbrechung und Gegenkanonisierung (Marchardt 2005; Mörsch et al. 2009; Graham, Shadya 2007; → Rodrigo 2012; Sternfeld 2005). Der Begriff Hegemonie bezeichnet in diesem Zusammenhang das in kapitalistisch organisierten Demokratien westlicher Prägung vornehmlich anzutreffende Herrschaftsverhältnis, welches auf gesellschaftlichen Konsens statt auf gewaltsamer Durchsetzung gründet (Haug F. 2004, S. 3, nach Gramsci). Die Ideen, welche dem Konsens unterliegen, stellen sich dabei für die Mehrheit als wahr und normal dar. Die Mitglieder einer Gesellschaft akzeptieren die hegemoniale Ordnung, sie leben nach ihren Regeln und Codes (Demirovic 1992, S.134). Der Konsens, welcher der hegemonialen Ordnung zu Grunde liegt, ist dabei umkämpft, er wird ständig neu ausgehandelt. Daher ist Kritik an der Hegemonie Bestandteil der hegemonialen Ordnung. Hegemoniekritik kann also nicht behaupten, sich ausserhalb der von ihr kritisierten Verhältnisse zu befinden. Sie tendiert dazu, selbst hegemonial zu werden, selbst den gesellschaftlichen Konsens darzustellen. An diesem Punkt setzt eine Kulturvermittlung an, die sich als hegemoniekritische Praxis versteht. Kulturinstitutionen und die künstlerische Produktion gehören zu den zentralen Orten, an denen die hegemoniale Ordnung ausgehandelt wird. Durch das, was sie anbieten, und durch die Formen, wie sie es anbieten, aber auch durch ihre Arbeitsverhältnisse, Ökonomien, Handlungsräume und die Art ihrer Sichtbarkeit sind sie permanent an der Herstellung und Bestätigung, potentiell aber eben auch an der Durchkreuzung und Verschiebung von gesellschaftlichen Normen und Werten, Ein- und Ausschlüssen, Macht und Markt beteiligt. Die Kulturvermittlung wiederum ist nicht nur in der Kulturproduktion, sondern auch im pädagogischen Bereich verankert, an dem ebenfalls Hegemonie hergestellt, kritisiert und umgearbeitet wird. Kulturvermittlung steht daher in jeder Situation vor der Wahl, bestehende hegemoniale Setzungen zu bestätigen und zu reproduzieren oder zu ihnen in kritische Distanz zu gehen und sie umzuarbeiten. Letzteres bedeutet zunächst einmal, «sich selbst zu widersprechen» (Haug F. S.4–38): Die unhinterfragten Selbstverständlichkeiten des eigenen Arbeitsfeldes in den Blick zu nehmen, die versteckten Normen und Werte in der Kulturvermittlung selbst zu analysieren. Hegemoniekritische Kunstvermittlung will darüber hinaus die Institutionen und Verhältnisse, in denen sie stattfindet, nicht unverändert lassen. Eine Kritik ohne Handlungsvorschläge stünde in ihrer Selbstgenügsamkeit in einem Gegensatz zu dem Anspruch von Vermittlung, → Situationen des Austauschs, herzustellen, wobei damit durchaus nicht immer ein harmonischer, sondern eben auch ein widerstreitender und widerständiger (Sturm 2002a) gemeint sein kann.2 Kulturvermittlung, die sich in diesem Sinn als kritische Praxis begreift, versucht entsprechend, zu einem Neu-Denken und Neu-Erfahren von Begründungen für die Kulturvermittlung zu kommen. Sich selbst zu widersprechen bedingt ein Projekt, das auf Bejahung angelegt ist (Haug F. 2004, S.4–38).
Die folgenden Texte für Verweilende versuchen, entlang der Leitfrage ihres Kapitels die zweifache Bewegung einer Kulturvermittlung zwischen Kritik und Neudenken der Praxis nachzuzeichnen. Zuerst werden jeweils Spannungsverhältnisse, in denen sich die Kulturvermittlung in Bezug auf jede Kapitelfrage bewegt, aus hegemoniekritischer Perspektive dargestellt. Dann werden Überlegungen dazu angestellt, welche Handlungs- und Umarbeitungsmöglichkeiten sich jeweils in Bezug auf diese Spannungsverhältnisse eröffnen. Die nächste darauf folgende Schleife – nämlich die daraus resultierenden Handlungsalternativen wiederum auf ihre hegemoniale Verfasstheit und die damit einhergehenden Herrschaftspraktiken und Widersprüche zu befragen – ist in den Texten nur angedeutet durch den Hinweis, dass die bestehenden Spannungsverhältnisse grundsätzlich nicht aufzulösen sind, sondern dass es darum gehen sollte, in ihnen zu arbeiten, sie informiert und bewusst zu gestalten.
1 «Dieser globale Kulturbegriff erhielt […] durch Johann Gottfried Herder, insbesondere in dessen von 1784 bis 1791 erschienenen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, seine für die Folgezeit verbindliche Form. Der Herdersche Kulturbegriff ist durch drei Momente charakterisiert: durch die ethnische Fundierung, die soziale Homogenisierung und durch die Abgrenzung nach außen.» (Welsch 1995)
2 Und wobei diejenigen, die sich an der Entwicklung und Realisierung von Handlungsvorschlägen versuchen, nicht zwangsläufig die gleichen Personen sein müssen wie die, die die Analyse vornehmen.
Literatur und Links
Der Text basiert in Teilen auf folgenden bereits erschienenen Beiträgen:
- Mörsch, Carmen: «Socially Engaged Economies: Leben von und mit künstlerischen Beteiligungsprojekten und Kunstvermittlung in England», in: Texte zur Kunst, Nr. 53, März 2004, «Erziehung» [14.10.2012]; → MFV0101.pdf (Mörsch 2004a)
- Mörsch, Carmen: «Watch this Space! – Position beziehen in der Kulturvermittlung», in: Sack, Mira, et al. (Hg.): Theater Vermittlung Schule (subTexte 05), Zürich: Institute for the Performing Arts and Film, 2011
- Aicher, Linda: Kinderkonzerte als Mittel der Distinktion. Soziologische Betrachtung von Kinderkonzerten in Wien anhand von Pierre Bourdieus kultursoziologischem Ansatz, Wien: Wirtschaftsuniversität, Schriftenreihe 2. Forschungsbereich Wirtschaft und Kultur, 2006 [25.7.2012]; → MFV0102.pdf
- Allen, Felicity: «Situating Gallery Education», in: Tate Encounters [E]dition 2: Spectatorship, Subjectivity and the National Collection of British Art, Februar 2008 [25.7.2012]; → MFV0106.pdf
- Benjamin, Walter: «Programm eines proletarischen Kindertheaters», in: Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften, Band 2/2, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977
- Bérardi, Jean-Charles; Effinger, Julia: «Kulturvermittlung in Frankreich», in: Mandel, Birgit (Hg.): Kulturvermittlung zwischen kultureller Bildung und Kulturmarketing, Bielefeld: transcript, 2005
- Berghahn, Klaus (Hg.): Friedich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen. Mit den Augustenburger Briefen, Stuttgart: Reclam, 2000
- Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982
- Caillet, Elisabeth: A l’approche du musée, la médiation culturelle, Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1995
- Caune, Jean: Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles, Grenoble: Pug, 1999
- Demirovic, Alex: «Regulation und Hegemonie: Intellektuelle, Wissenspraktiken und Akkumulation», in: Demirovic, Alex, et al. (Hg.): Hegemonie und Staat: Kapitalistische Regulationen als Projekt und Prozess, Münster: Westfälisches Dampfboot, 1992, S. 128–157
- Duvignaud, Jean; Lagoutte, Jean: Le théâtre contemporain – culture et contre-culture, Paris: Larousse, 1986
- Effinger, Julia: Médiation Culturelle: Kulturvermittlung in Frankreich. Konzepte der Kulturvermittlung im Kontext von Kultur- und Theaterpolitik, Diplomarbeit im Studiengang Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis, Universität Hildesheim, 2001
- Freire, Paulo: Erziehung als Praxis der Freiheit, Stuttgart: Kreuz, 1974
- Graham, Janna; Shadya, Yasin: «Reframing Participation in the Museum: A Syncopated Discussion», in: Pollock, Griselda; Zemans, Joyce: Museums after Modernism: Strategies of Engagement, Oxford: Blackwell, 2007, S. 157–172
- Haug, Frigga: «Zum Verhältnis von Erfahrung und Theorie in subjektwissenschaftlicher Forschung», in: Forum Kritische Psychologie 47, 2004, S.4–38
- Haug, Wolfgang Fritz: «Hegemonie», in: Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Hamburg: Argument, 2004, S. 1–25
- Irbouh, Hamid: Art in the Service of Colonialism: French Art Education in Morocco, 1912–1956, New York: Tauris Academic Studies, 2005
- Lichtwark, Alfred: Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken: Nach Versuchen mit einer Schulklasse herausgegeben von der Lehrervereinigung zur Pflege der künstlerischen Bildung, Dresden: G. Kühtmann, 1900 (erste Auflage 1897)
- Marchart, Oliver: «Die Institution spricht. Kunstvermittlung als Herrschafts- und als Emanzipationstechnologie», in: Jaschke, Beatrice, et al. (Hg.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen. Wien: Turia und Kant, 2005, S.34–58
- Mauthner, Fritz: Sprache und Grammatik. Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Band III, Stuttgart/Berlin: J.G. Cotta, 1913
- Mörsch, Carmen (2004b): «From Oppositions to Interstices: Some Notes on the Effects of Martin Rewcastle, the First Education Officer of the Whitechapel Gallery, 1977–1983», in: Raney, Karen (Hg.): Engage No. 15, Art of Encounter, London, 2004, S. 33–37
- Mörsch, Carmen und das Forschungsteam der documenta 12 Vermittlung: Kunstvermittlung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12, Zürich: Diaphanes, 2009
- Rodrigo, Javier: «Los museos como espacios de mediación: políticas culturales, estructuras y condiciones para la colaboración sostenible en contextos», in: LABmediació del CA Tarragona Obert per Refelxió: Un Laboratori de treball en xarxa i producció artística i cultural,Tarragona: CA Centre d‘Art Tarragona, Ajuntament de Tarragona, 2012, S. 43–39 (Orginaltext in Catalan, spanische Übersetzung) [14.10.2012]; → MFV0107.pdf
- Seefranz, Catrin; Saner, Philippe: Making Differences: Schweizer Kunsthochschulen. Explorative Vorstudie, Zürich: IAE [25.7.2012]; → MFV0103.pdf
- Sternfeld, Nora: «Der Taxispielertrick. Vermittlung zwischen Selbstregulierung und Selbstermächtigung», in: Jaschke, Beatrice, et al. (Hg.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen, Wien: Turia und Kant, 2005, S. 15–33
- Sturm, Eva: Im Engpass der Worte. Sprechen über moderne zeitgenössische Kunst, Berlin: Reimer, 1996
- Sturm, Eva (2002a): «Woher kommen die KunstvermittlerInnen? Versuch einer Positionsbestinmung» in: Sturm, Eva; Rollig, Stella (Hg.): Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum: Art/Education/Cultural Work/Communities, Wien: Turia und Kant, 2002, S. 198–212
- Sturm, Eva (2002b): «Kunstvermittlung als Widerstand», in: Schöppinger Forum der Kunstvermittlung. Transfer. Beiträge zur Kunstvermittlung Nr. 2, 2002, S. 92–110
- Welsch, Wolfgang: «Transkulturalität. Die veränderte Verfasstheit heutiger Kulturen», in: Institut für Auslandsbeziehungen (Hg.): Migration und Kultureller Wandel, Schwerpunktthema der Zeitschrift für Kulturaustausch, 45. Jg. 1995 / 1. Vj., Stuttgart 1995 [27.7.2010]; → MFV0104.pdf
- Wittlin, Alma: The Museum: its History and its Tasks in Education, London/New York: Routledge, 1949
- Working Men Colleges [14.10.2012]